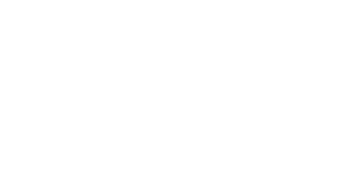Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Der Bundesgerichtshof musste im Herbst 2016 darüber entscheiden, ob ein Kind den Totschlag durch Unterlassen gegenüber seiner Mutter verwirklicht hat, obwohl die beiden in zerrütteten Familienverhältnissen gelebt haben.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Tochter und Mutter leben und wohnen in einem gemeinsamen Haushalt, obwohl sie ein schwieriges Verhältnis zueinander pflegen. Die Mutter ist stark alkoholkrank und kann aufgrund ihrer Sucht nicht mehr aktiv am sozialen Leben teilnehmen. Monatelang habe Sie auf dem gemeinsamen Sofa in der Wohnung „dahinvegetiert“ und sich psychisch aufgegeben. Dies führte dazu, dass Sie jegliche Mahlzeiten verweigerte und dadurch einen erheblichen Gewichtsverlust erlitt, wobei Sie zum Zeitpunkt ihres Todes noch 26 Kilogramm gewogen habe.
Der Tod der Mutter geschah in ständiger Betrachtung der 18-jährigen Tochter, welche aufgrund der jahrelangen Vernachlässigung aufgrund der Alkoholsucht ihrer Mutter nicht eingriff und laut den erhobenen Beweisen des Tatgerichts deren Tod billigend in Kauf nahm. Es folgte eine Verurteilung aufgrund der Tötung durch Unterlassen nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB.
Dagegen wandte sich die Tochter mit einer Revision zum Bundesgerichtshof. Ein sogenanntes unechtes Unterlassungsdelikt nach § 13 Abs. 1 StGB kann nur von Personen erfüllt werden, welche gegenüber dem Opfer besondere Verhältnis – und Schutzpflichten hegen, die sogenannte „Garantenpflicht“. Eine solche ist unter normalen Umständen zwischen Mutter und Tochter zu bejahen, da dies als „enge Lebensbeziehung“ gedeutet werde und zudem familienrechtliche Aspekte dazukommen, welche eine solche Pflicht begründen.
Aufgrund des zerrütteten Familienverhältnisses zwischen Tochter und Mutter argumentierte die Tochter jedoch, dass Sie sich in keiner Weise für ihre Mutter verantwortlich fühlte und aufgrund der vorangegangenen schweren Familienzeit auch kein Verhältnis mehr mit ihr pflegte. Aufgrund dieser Umstände könne ihr keine Garantenpflicht unterstellt werden, welche die Verurteilung zu einem Totschlag durch Unterlassen nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB rechtfertige.
Der Bundesgerichtshof sah diese Garantenstellung der Tochter trotz der schwierigen Familienverhältnisse als erfüllt an und bestätigte somit das Urteil des Landgerichts. Die Richter aus Karlsruhe begründeten dies wie folgt:
Auch wenn kein gutes Blut zwischen den Familienmitgliedern herrschte und das Verhältnis nicht von gegenseitigem Vertrauen und Zuneigung geprägt war, so begründe der gemeinsame Haushalt der Beiden und die direkte Verwandtschaft ersten Grades eine Schutzpflicht aus § 1618a BGB. Dieser Paragraph aus dem Familienrecht besagt, dass sich Eltern und Kinder einander Beistand und Rücksicht schuldig sind. Ein solcher Grundsatz aus dem Zivilrecht lasse sich laut der Richter auch problemlos in das Strafrecht übertragen und begründet im vorliegenden Fall die Garantenstellung der 18-jährigen Tochter.
Diese hat sich somit durch das Nichtergreifen von Hilfsmaßnahmen gegenüber ihrer Mutter zu einem Totschlag durch Unterlassen nach §§ 212 Abs. 1, 13 Abs. 1 StGB strafbar gemacht.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 13.10.2016 – 3 StR 248/16 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Bundesgerichtshof macht mit seinem Urteil vom September 2016 klar, dass das Strafrecht auch im sogenannten „Ganovenmilieu“ angewandt werden kann und auch illegale Rauschmittel unter den strafrechtlichen Begriff des schutzwürdigen Vermögens fallen.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im September 2012 sollte eine große Menge an Drogen an einen Zielort im Saarland ausgeliefert werden. Als auch Stunden nach der geplanten Ankunft der Bote immer noch nicht in Sicht war, beauftrage der Besteller des Rauschgiftes eine Person damit, den Kurier aufzufinden und unter Druck zu setzen. Als der Beauftrage den Drogenschmuggler ausfindig machte, bedrohte er diesen mit einer Schusswaffe und forderte die sofortige Herausgabe der Drogen oder einen Betrag von äquivalenten Betrag von 60.000 Euro in bar. Da das Opfer lediglich das bestellte Kilogramm Amphetamin dabei hatte, übergab er dies, um schwerwiegenden Verletzungen unter Drohung mit der Waffe zu entkommen.
Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei, welche sowohl den Kurier als auch den Erpresser ausfindig machen konnten, welcher die Behörden auch zum drahtziehenden Besteller der Drogen führte. Dieser wurde aufgrund des Vorfalls vor dem Landgericht Aachen wegen Anstiftung zur besonders schweren räuberischen Erpressung angeklagt und verurteilt, §§ 253 Abs. 1, 255, 250 Abs. 1 Nr. 2 lit. a StGB.
Dagegen wandte er sich mit einer Revision zum Bundesgerichtshof und argumentierte, dass der sogenannte erforderliche „Vermögensschaden“ beim Opfer gar nicht eingetreten sein könne, da die Drogen unter das Betäubungsmittelgesetz fallen und demnach nicht im strafrechtlichen Vermögensbegriff enthalten sind.
Die Richter des Bundesgerichtshof waren jedoch anderer Auffassung und bestätigten das Urteil des Landgerichts. Nach ihrer Ansicht kenne die Rechtsordnung im Bereich der Vermögensdelikte kein schutzunwürdiges Vermögen. Auch an Sachen wie illegalem Rauschgift, welches jemand aufgrund einer strafbaren Handlung besitzt und als Tatmittel zur Begehung geplanter Straftatet bereitstellt, könne unbeschadet ein Betrug oder eine Erpressung erwirkt werden.
Der Bundesgerichtshof bemisst den Vermögensschaden demnach an einem objektiven Maßstab des wirtschaftlichen Wertes auf dem freien Weltmarkt. Demnach haben auch Betäubungsmittel bei wirtschaftlicher Betrachtung einen erheblichen Wert und bieten deshalb einen ganz besonderen Anreiz, mit diesen Handel zu treiben.
Des Weiteren wäre es kriminalpolitisch fragwürdig, dass Strafrecht nur bis an die „Mauern des Ganovenmilieus“ reichen zu lassen und ab dort eine Grenze des „rechtsfreien Raumes“ zu schaffen, in welchem der Staat keinen Schutz biete. Dies würde den Tätern falsche Signale einer „Anarchiezone“ senden und müsse weitestgehend verhindert werden. Zudem würde der Gedanke der Einheit der Rechtsordnung untergraben.
Mit diesem Urteil setzt der Bundesgerichtshof neue Maßstäbe in Sachen Vermögensschutz und stellt sogar illegal erlangten Besitz oder Eigentum unter den Schutzmantel des Strafgesetzbuches.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 22.09.2016 – 2 StR 27/16 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Bundesgerichtshof bejahte in seinem Beschluss vom 15.02.2017 die Strafbarkeit wegen Nachstellung mit Todesfolge, weil ein Ex-Freund seiner Ex-Freundin derart nachstellte, dass diese sich selbst tötete.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im Sommer 2014 ging das spätere Tatopfer mit dem Angeklagten eine Beziehung ein. Diese zerbrach jedoch bereits im Februar 2015 aufgrund der großen Eifersucht des Angeklagten. Die Beziehung nahm ein abruptes Ende, da das Tatopfer den Angeklagten bei einem geplanten Telefonat versehentlich mit dem Vornamen ihres früheren Liebhabers ansprach. Dies kränkte den Täter so sehr, dass er die Beziehung unter Groll beendete.
In der Folgezeit bis März 2015 kam es zu massiven Belästigungen seitens des Angeklagten. Nach den Feststellungen des Landgerichts sendete er dem Opfer zahllose Textnachrichten mit hasserfüllten Beleidigungen und Bedrohungen. Zudem verfolgte er Sie bei ihren täglichen Routinewegen zu ihrem Arbeitgeber oder in den Supermarkt. Des Weiteren störte er ihre Eltern und Freunde mit lästigen Telefonanrufen und beschädigte Teile ihres Eigentums, beispielsweise durch Aufschlitzen der Reifen an ihrem Auto.
Als Folge der Handlungen des Angeklagten war das Tatopfer stark verängstigt, verzweifelt und letztendlich nicht mehr arbeitsfähig. Sie konnte nicht mehr alleine wohnen und übernachtete ständig bei ihren Eltern, in ständiger Angst vor weiteren Bedrohungen und dem Erscheinen des Anklagten. Sie entwickelte eine starke psychisch-depressive Störung, welche sich nachhaltig verstärkte, als ihr Arbeitgeber ihr weitere Nachrichten zeigte, welche der Angeklagte über Sie in der Kollegenschaft verbreitete. Aufgrund des extremen Schamgefühls gegenüber ihrer Mitmenschen und der Feststellung, dass der Angeklagte durch seine Belästigungen ihr Leben „vollständig zerstört“ hat, erhängte sie sich im November 2015 im Keller ihrer Wohnung.
Das erstinstanzlich zuständige Landgericht Stuttgart verurteilte den Angeklagten wegen seines Verhalten unter anderem wegen Nachstellung mit Todesfolge gemäß § 288 Abs. 3 StGB. Gegen das Urteil legte der Angeklagte Revision zum Bundesgerichtshof ein und argumentierte, dass die Selbsttötung des Opfers letztendlich auf einer eigenverantwortlichen Entscheidung beruhte und ihm deswegen objektiv nicht zugerechnet werden kann.
Der Bundesgerichtshof bestätigte die Entscheidung des Landgerichts und wies die Revision des Angeklagten zurück. Aufgrund des Vorliegens eines erfolgsqualifizierten Delikts nach § 18 StGB müsse ein sogenannter „spezifischer Gefahrenzusammenhang“ vorliegen. Dieser liegt seitens der Richter aus Karlsruhe vor, denn die extreme Nachstellung, welche lebensverändernde Züge angenommen habe, hat eine solche Gefahr begründet, welche nach allgemeiner Lebenserfahrung sich auch in einem tödlichen Ausgang niederschlagen kann.
Auch die Zurechnung des Ursachenzusammenhangs müsse dem Angeklagten zugerechnet werden, obwohl das Opfer die Entscheidung des Suizids „selbst“ getroffen habe. Dennoch handelte es sich nicht um eine völlig autonome Entscheidung, sondern kann „als letzte Steigerung der tiefgreifenden Beeinträchtigung der Lebensführung des Opfers dargestellt werden“. Der § 238 StGB schütze das Rechtsgut der Privatsphäre und der freien Persönlichkeitsentfaltung, demnach erfasse er nicht nur Fälle, in welchen das Opfer auf der Flucht des nachstellenden Täters zu Tode kommt, sondern auch solche, in welchen das Opfer vom Täter in den Selbstmord getrieben wird.
Das Urteil des Landgerichts, welches den Angeklagten zu eine Freiheitsstrafe von fünf Jahren und sechs Monaten verurteilte, ist somit rechtskräftig.
BGH 4 StR 375/16 – 15. Februar 2017 (LG Stuttgart)
close up of prisoner hands in jail.
Foto: AdobeStock Nr.: 216845226 sakhorn38
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Anwalt für Strafrecht
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Der Bundesgerichtshof hat im Sommer 2017 entschieden, dass das Verwenden eines Schlüssels als „Messerattrappe“ als Nötigungsmittel dazu geeignet ist, einen schweren Raub im Sinne des § 250 StGB anzunehmen, welcher eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren fordert und somit nicht mehr auf Bewährung ausgesetzt werden kann.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte klingelte spontan an einer Wohnungstür in einem Behindertenwohnzentrum. Das Opfer lag in ihrem Bett und öffnete mit einem automatischen Türöffner die Tür, in der Erwartung ihres Therapeuten. Als Sie den Angeklagten erblickte, gab sich dieser als Lieferant aus. Da das Opfer nichts bestellt habe, forderte Sie ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Dieser sah sich stattdessen in der Wohnung um, um potenzielles Diebesgut zu erspähen. Nachdem er über die potenzielle Beute enttäuscht war, kehrte er zur alten Dame zurück, hielt ihr einen Schlüssel mit der Länge von sechs Zentimetern an den Hals und forderte die Frau auf, ihm alles Geld zu geben, welches Sie in der Wohnung aufbewahrte. Zum Zeitpunkt der Gewaltanwendung ging die Frau davon aus, dass es sich bei dem Gegenstand nicht um einen Schlüssel, sondern um ein Messer des Angeklagten handelt.
Die Frau ging der Forderung des Täters nach und zeigte ihm eine Schüssel mit Geld, in welcher sich 14 Euro (!) befanden. Dieser ergriff das Geld und ging seiner Wege.
Das Landgericht Aachen wertete den Schlüssel als „sonstiges Werkzeug“ im Sinne des § 250 Abs. 1 Nr. 1 lit. b StGB und verurteilte den Angeklagten daher wegen der Begehung eines schweren Raubes. Dagegen wendet sich dieser mit einer Revision zum Bundesgerichtshof.
Dieser bestätigt die Entscheidung des Landgerichts und wies die Revision daher zurück. Die Richter aus Karlsruhe begründeten dies wie folgt:
Damit der Anwendungsbereich des § 250 Abs. 1 Nr. 1 lit. b StGB nicht ausufert, ist es notwendig, ihm im Sinne der richterlichen Rechtsfortbildung zu begrenzen. Demnach reicht es nicht aus, wenn der Täter irgendeinen Gegenstand zur Überwindung des Widerstandes gegen Dritte einsetzt. Die Anwendbarkeit des § 250 Abs. 1 Nr. 1 lit. b StGB sei zudem zu verneinen, wenn die Drohungswirkung des Drohungsmittels nicht auf dem objektiven Erscheinungsbildes des Gegenstandes selbst, sondern allein auf den täuschenden Erklärungen des Täters beruht. Denn liegt aus der Sicht eines objektiven Betrachters auf das äußere Erscheinungsbild die objektive Ungefährlichkeit des Gegenstandes offenkundig vor, so sei das Strafmaß des § 250 Abs. 1 StGB zu extrem und würde seitens der Handlung keine Rechtfertigung erlangen, denn die Schwelle der Gefährlichkeit der Lage wäre objektiv nicht überschritten, sondern würde auf einer subjektiven Täuschung des Opfers beruhen.
Bezüglich eines haushaltsüblichen Schlüssels von ca. 6 cm Länge ist der Einzelfall entscheidend. Obwohl das Opfer glaubte, dass es sich hierbei um ein Messer handelt und somit die konkludente Täuschung des Täters im Vordergrund steht, handelt es sich seitens der Richter bei dem Schlüssel nicht etwa um einen harmlosen Gegenstand wie ein Plastikrohr oder einen Holzstock, welcher bei objektiver Betrachtung keinerlei Gefährlichkeit zugerechnet werden kann.
Der Schlüssel ist laut Aussage des Gerichts aufgrund seiner Kantigkeit und seinem Gewicht in besonderen Einzelfall dazu geeignet, erhebliche Verletzungen, v.a. im Halsbereich des Opfers bspw. durch Schnittbewegungen zu ermöglichen. Das täuschende Verhalten des Angeklagten, um die Drohwirkung mit dem Schlüssel zu erfüllen, steht der objektiven Gefährlichkeit des Gegenstandes nicht entgegen.
Die rechtlichen Feststellungen des Landgerichts Aachen tragen diese Behauptungen und sind somit keiner Rüge unterlegen. Die Revision wurde zurückgewiesen, dass Urteil des Landgerichts durch den BGH bestätigt.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 12.07.2017 – 2 StR 160/16 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Bundesgerichtshof hat sich Anfang des Jahres bezüglich der verminderten Schuldfähigkeit im Sinne des § 21 StGB ausgesprochen und eine solche in Bezug auf Drogenabhängigkeit nur in Ausnahmefällen gebilligt.
In dem zugrundeliegenden Fall musste sich ein Drogenabhängiger im Juli 2016 vor dem Landgericht Frankfurt am Main aufgrund mehrerer Diebstähle als auch einem besonders schweren Raub verantworten, weshalb er zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde. Obwohl der Angeklagte in Hohen Dosen Betäubungsmittel wie Crack, Heroin, Alkohol sowie Benzodiazepine zu sich nahm, ging das Gericht nicht von einer verminderten Schuldfähigkeit aus. Zwar habe der Angeklagte aufgrund der jahrelangen Abhängigkeit eine Persönlichkeitsveränderung durchlebt, da sich sein Leben nur noch allein um die Finanzierung, den Erwerb sowie den Konsum von Drogen gedreht habe, dennoch war er sich bezüglich der persönlichen Vorwerfbarkeit der begangenen Taten in vollem Bewusstsein.
Gegen dieses Urteil richtet sich der Angeklagte mit einer Revision zum Bundesgerichtshof.
Der Bundesgerichtshof führte seinerseits aus, dass eine durchgehende Drogenabhängigkeit an sich noch keine Annahme einer verminderten Schuldfähigkeit nach § 21 StGB begründe. Die Schuld des Täters müsse zum Tatzeitpunkt vermindert sein. Dies ist jedoch lediglich dann gegeben, wenn sich der Täter in einer ganz erheblichen Entzugssymptomatik oder einem akuten Intoxikationszustand während des Tathergangs befindet. Dies sei jedoch bei dem vom Angeklagten begangenen Taten nicht gegeben.
Vielmehr geht es ihm darum, seine dauerhafte Drogenabhängigkeit als „Dauerentschuldigungsgrund“ geltend zu machen und demnach auf all seine Einzeltaten anzuwenden. Diese Konstellation ist seitens des Bundesgerichtshof jedoch nur in extremen Ausnahmefällen zu gewähren. Dies wäre demnach nur der Fall, wenn es sich bei dem Angeklagten um einen Rauschgiftsüchtigen handelt, welcher jahrelang Betäubungsmittel missbraucht hat und dies zu einer schweren Persönlichkeitsveränderung geführt habe und der Täter zudem unter starken Entzugserscheinungen leidet und durch diese dazu getrieben wird, sich mittels Straftaten Drogen zu verschaffen, um seine Symptome zu lindern.
Da eine Persönlichkeitsdepravation seitens des Landgerichts Frankfurt angenommen wurde, ist besteht grundsätzlich die Möglichkeit zur Anwendung des § 21 StGB. Warum diese Persönlichkeitsveränderung eine erhebliche Verminderung der Steuerfähigkeit bewirkt haben soll, lässt sich den Urteilsgründen und Feststellungen des Landgerichtes jedoch nicht nachvollziehbar entnehmen. Der Angeklagte habe dies jedoch vorgetragen, jedoch müsse er beweisen, dass die Sucht zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Hemmungsvermögens im Sinne des § 21 StGB geführt habe. Da dies jedoch nicht von vornherein ausgeschlossen werden kann, ist der Fall zur Neuverhandlung an das Landgericht Frankfurt am Main zurückzuweisen.
Zudem ist es notwendig, dass ein weiterer Gutachter über den Zustand des Angeklagten entscheidet und neben körperlichen Beeinträchtigungen auch die psychischen Beweggründe für die kriminellen Vorgänge bewertet.
Letztendlich konkretisiert der Bundesgerichtshof die Annahme der verminderten Schuldunfähigkeit durch diesen Beschluss weiter und legt den Gerichten die Voraussetzungen der Annahme einer Schuldverminderung nach § 21 StGB offen, welche im Einzelfall durch detaillierte Feststellungen auch bei einer durchgehenden Drogenabhängigkeit bejaht werden kann.
BGH, Beschluss vom 18.01.2017 – 2 StR 436/16 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Amtsgericht München hat im Sommer 2017 über einen Mann geurteilt, welcher vorsätzlich eine unerlaubte Schusswaffe erworben und mithilfe dieser seine damalige Freundin, sowie ihren Stiefvater in zwei Fällen ernsthaft bedroht hat. Seitens des Tatrichters wurde eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung mit anschließender Einweisung in eine Entziehungsanstalt für elf Monate verhängt.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Dem Angeklagten konnte nachgewiesen werden, dass er im Jahr 2015 auf einem Friedhof von einem tschechischen Waffenhändler einen Revolver, sowie große Mengen dazugehöriger Munition erstanden hat. Er bewahrte die Handwaffe in seiner Wohnung auf, ohne dafür eine Erlaubnis zu besitzen.
Kurz nach dem Kauf und Inbesitznahme der Waffe kam es zu einem Streit zwischen ihm und seiner Lebensgefährtin, weshalb er den Revolver aus seinem Versteck holte, diesen spannte und auf seine Freundin richtete, um dieser ihr Ableben in Aussicht zu stellen. Obwohl Sie in der Folgezeit um ihr Leben bangte, zeigte Sie den Beschuldigten nicht bei der Polizei an.
Ca. zwei Jahre nach dem Vorfall kam es erneut zu einem Streit. Auch dieses Mal eskalierte die Situation dermaßen, dass der Angeklagte erneut den Revolver hervorholte, mit Munition ausstattete und die Spannvorrichtung betätigte, so dass die Waffe als schussbereit gelte, welche der Frau direkt ins das Gesicht gehalten wurde. Als der zufällig anwesende Stiefvater der Freundin das Zimmer der Streitenden betrat, erblickte er die Situation und versuchte den Beschuldigten zu besänftigen. Daraufhin wurde dieser umso wütender und bedrohte nun auch den Stiefvater mit der geladenen Pistole. Beide Geschädigten ließen sich vor Gericht ein, dass Sie diese Drohung sehr ernst nahmen und zum Teil „Todesangst“ verspürten.
Als die Taten vor dem Amtsgericht München verhandelt wurden, war der Verurteilte geständig und entschuldigte sich bei den beiden Geschädigten. Dennoch verhängte das Gericht ein scharfes Strafmaß. Für den Erwerb des Revolvers, sowie die erste Bedrohung der Frau im Jahr 2015 war eine Freiheitsstrafe unter Bewährung im Gespräch. Da zum Zeitpunkt der Verhandlung jedoch noch eine weitere Freiheitsstrafe eines anhängigen Verfahrens des Amtsgerichts Fürstenfeldbruck vorlag, wurde der Schuldspruch auf die Gesamtstrafe von zwei Jahren ohne Bewährung verschärft.
Des Weiteren urteilte der Richter des Amtsgerichts nochmals gesondert über den Vorfall der zweiten Bedrohung im Jahre 2017. Diese sei derart von Unrecht geprägt, dass eine gesonderte zusätzliche Freiheitsstrafe von elf Monaten zu verhängen sei.
Zur Höhe der Strafe wird im Urteil ausgeführt, dass die Folgen für die Opfer extrem seien und daher stark zu Lasten des Verurteilten zu werten waren. Die beiden Opfer leiden bis heute noch an Schlaflosigkeit sowie Panikattacken und spontan auftretenden Angstzuständen, welche Sie im Alltagsleben stark einschränken und zudem eine dauerhafte psychologische Betreuung notwendig machen. Zudem sei der verantwortungslose Umgang mit der Waffe im konkreten Fall strafschärfend zu werten. Die Freundin sowie der Stiefvater waren Laien in Bezug zu Waffen. Hätte der Angeklagte lediglich drohen wollen, so wäre eine Spannung des Revolvers nicht nötig gewesen, um eine derartige Drucksituation seitens der Geschädigten aufzubauen. Da die Waffe jedoch jederzeit schussbereit war, lag eine extrem hohe abstrakte Gefährlichkeit der Lage vor, welche die Freiheitsstrafe in dem vorliegenden Umfang rechtfertige.
Nach den Feststellungen des Sachverständigen habe der Angeklagte einen Hang zu übermäßigen Alkoholkonsum, welcher die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt erfordert. Ohne eine angemessene Therapie sei nach dem psychologischen Gutachten zu erwarten, dass er weitere Straftaten begehe. Demnach wurde die Freiheitsstrafe der zweiten Bedrohung in eine Maßregelungseinweisung in eine Entziehungsanstalt umgewandelt. Letztendlich wurde der Revolver mitsamt erstandener Munition von den Behörden sichergestellt und eingezogen (AG München, Urteil vom 09.08.2017 – 1112 Ls 117 Js 103839/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Die Richter des Oberlandesgerichts Hamm mussten sich im Jahr 2017 mit der Frage auseinandersetzen, ob ein vermummter Hooligan, welcher sich bereits im Fan-Bus seines Vereins auf dem Parkplatz befand, dennoch gegen das Vermummungsverbot aus §§ 27 Abs. 2 Nr. 2, 17a Abs. 2 Nr. 1 VersammlG verstoßen kann.
Es liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der seinerzeit 21-jährige Angeklagte war Anhänger des VfB Stuttgart und besuchte im Mai 2015 ein Bundesligaauswärtsspiel in der Benteler Arena in Paderborn. Der Angeklagte reiste mit anderen Fußballanhängern in einem gemeinsamen Fan-Bus des VfB Stuttgart an, welcher auf dem zum Stadiongelände gehörenden Gästeparkplatz geparkt wurde. Nachdem der Abpfiff des Spiels erfolgte, gingen die Fans ihrer Wege und versammelten sich an den ihn zugeilten Reisebussen zur gemeinsamen Abreise. Aus dieser Konstellation heraus kam es zu Fangesängen und Tumulten der Stuttgarter Fans, wobei auch verbotene Pyrotechnik gezündet wurde.
Die eingesetzten Polizeikräfte forderten die Anhänger daraufhin auf, sich ruhig zu verhalten, den Tumult aufzulösen und sich in die Busse zu begeben. Als der Angeklagte, welcher sich bereits im Bus befand und bis dato nicht aktiv an den Unruhen teilgenommen hat, dies bemerkte, begann er, sich mit einem roten Schal sowie einer Sturmhaube und einer Kapuzenjacke derart zu maskieren, dass lediglich die Augenpartien zu erkennen waren. Mit dem Ziel, die Tumulte unter Anonymität weiter anzuheizen und eine Identifizierung zu verhindern, verließ er den Bus und provozierte die eingesetzten Polizeibeamten auf dem Gästeparkplatz, in dem er von außen aggressiv mit der flachen Hand auf die Blechverkleidung des Fan-Busses einschlug. Nachdem die Beamten ihn erfolglos aufforderten, diese Handlungen zu unterlassen, drohten Sie ihm Gewalt im Sinne des unmittelbaren Zwanges an. Andere Anhänger des VfB Stuttgarts konnten ihn vor Eskalation der Lage wieder in den Bus zurückdrängen. Die Identität des Angeklagten konnte letztendlich seitens der Beamten festgestellt werden.
Die Staatsanwaltschaft Paderborn klagte den Beschuldigten wegen eines vorsätzlichen Verstoßes gegen das Vermummungsgebot aus dem Versammlungsgesetz nach §§ 27 Abs. 2 Nr. 2, 17a Abs. 2 Nr. 1 VersammlG an. Seitens des Amtsgerichts wurde eine Geldstrafe von 1600 € festgesetzt.
Die Berufungsinstanz wurde vor dem Landgericht Paderborn ausgetragen, welches die erstinstanzliche Entscheidung des Amtsgerichts bestätigte. Daraufhin legte der Angeklagte Revision zum Oberlandesgericht ein, welche jedoch erfolglos blieb. „Das Landgericht habe alle Feststellungen rechtsfehlerfrei getroffen“, beschlossen die Richter. Dies wurde wie folgt begründet:
Die Annahme, dass das Versammlungsgesetz in dieser Konstellation anzuwenden ist, haben die Vorinstanzen richtig entschieden. Auch Fußballspiele sind als „Veranstaltungen unter freiem Himmel“ zu interpretieren und fallen somit unter die einschlägigen Vorschriften des Versammlungsgesetzes. Während der besagten Vermummungstat war der Angeklagte auch noch auf der Veranstaltung gewesen. Diese endet bei einem Fußballspiel nicht etwa mit dem Abpfiff, sondern erst dann, wenn das Gelände vollends verlassen wurde. Der Gästebusparklatz könne nach den Feststellungen noch zum Stadion gezählt werden, denn der Angeklagte hat sich in unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit dem zuvor besuchten Spiel noch selbst innerhalb der Umzäunung des Stadions befunden sowie ein für ihn dort zur Verfügung stehendes Mittel zum Abtransport genutzt. Somit gelte das Vermummungsverbot selbst innerhalb der Busse auf dem Parkplatzgelände.
An der Vermummung selbst sahen die Richter aufgrund der derartigen Maskierung keine Zweifel, denn es war lediglich die Augenpartie des Täters zu erkennen. Sach – oder Rechtsfehler, welche eine Revision begründen würden, lagen demnach nicht vor.
§ 17 a [Schutzwaffen- und Vermummungsverbot]
(1) Es ist verboten, bei öffentlichen Versammlungen unter freiem Himmel, Aufzügen oder sonstigen öffentlichen Veranstaltungen unter freiem Himmel oder auf dem Weg dorthin Schutzwaffen oder Gegenstände, die als Schutzwaffen geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren, mit sich zu führen.
(2) Es ist auch verboten, […]
Nr. 2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit sich zu führen, die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die Feststellung der Identität zu verhindern. […]
§ 27 Abs. 2 Nr. 2 [Verstoß gegen das Verbot von Waffen, Schutzwaffen, Vermummung; Zusammenrottung]
(2) Wer […]
Nr. 2. entgegen § 17 a Abs. 2 Nr. 1 an derartigen Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, teilnimmt oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung zurücklegt oder […] wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft (OLG Hamm, Beschluss vom 07.09.2017 – 4 RVs 97/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Bundesverfassungsgericht musste sich Ende 2017 mit der Frage auseinandersetzen, ob es einem Angeklagten zuzumuten ist, eine verlängerte Untersuchungshaft zu erdulden, wenn die zuständige Kammer des Gerichts arbeitsüberlastet ist. Die Richter aus Karlsruhe entschieden zugunsten des Angeklagten, welcher in seinen Grundrechten aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt wurde.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Beschwerdeführer ist ein Vietnamese, welcher aufgrund eines Haftbefehls des Amtsgerichts Landau an der Pfalz seit Juni 2016 in Untersuchungshaft sitzt. Im wird seitens der Staatsanwaltschaft die Einfuhr von 1,1 Kilogramm Metamphetamin vorgeworfen. Im Juli 2017 eröffnete das Landgericht Landau an der Pfalz das Hauptverfahren gegen den Angeklagten. Die Verzögerung sei auf eine Arbeitsüberlastung der zuständigen Strafkammer zurückzuführen. Nach einem Verhandlungstag kam es erneut zur Verschiebung der Termine. Erneut wurde als Grund für die Vertagung die Arbeitsüberlastung des Gerichts genannt. Eine Haftprüfung bzgl. der Verlängerung der U-Haft des Angeklagten gemäß §§ 121, 122 StPO wurde vom zuständigen Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken vorgenommen. Die Richter des OLG sahen jedoch keinerlei Anlass, die Untersuchungshaft des Beschwerdeführers aufgrund von weiteren Verzögerungen am Landgericht aufzuheben. Demnach wurde seitens des OLG die Fortdauer der Untersuchungshaft angeordnet.
Gegen diesen Beschluss wandte sich der Beschwerdeführer mithilfe einer Verfassungsbeschwerde. Er sieht sich aufgrund der Fortdauer der Untersuchungshaft in seinem Recht aus Art. 2 Abs. 2 Satz 2 GG verletzt, welches ihm das Recht auf persönliche Freiheit sowie den Bedürfnissen einer wirksamen und beschleunigten Strafverfolgung gewährleistet.
Im Grundsatz ist es lediglich gestattet, einen rechtskräftig verurteilten Straftäter die Freiheit zu entziehen. Gegenüber einem Verdächtigten ist dies wegen der Unschuldsvermutung aus Art. 20 Abs. 3 GG sowie Art. 6 Abs. 2 EMRK nur ausnahmsweise zulässig. Falls es dennoch dazu kommt, ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren, welcher sich meist dadurch ausdrückt, dass die Strafverfolgungsbehörden sowie Strafrichter alle möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die notwendigen Ermittlungen mit der gebotenen Schnelligkeit abzuschließen und eine zügige gerichtliche Entscheidung herbeizuführen, welche für klare Rechtsverhältnisse sorgt.
Die zugrundeliegende Untersuchungshaft kann aus Sicht des BVerfG nicht mehr als notwendig anerkannt werden, wenn ihre Fortdauer durch Verfahrensverzögerungen verursacht wurde, welche ihre Ursache nicht in dem konkreten Strafverfahren haben, denn dann bestehen diese nicht mehr in der Sphäre, welcher der Beschuldigte zu vertreten hat. Zwar können minimale Verfahrensverzögerungen die Fortdauer der Untersuchungshaft rechtfertigen, dennoch müssen sich auch diese Verzögerungen in einem vertretbaren und angemessenen Rahmen befinden, was im obig genannten Fall aufgrund der extremen Verlängerung nicht mehr angenommen werden kann.
Eine nicht nur kurzfristige Überlastung eines Gerichts könne insofern niemals Grund für die Anordnung einer Haftfortdauer sein, da ein solcher Umstand immer in den Verantwortungsbereich der staatlichen Rechtspflege falle und dem Beschuldigten nicht zugemutet werden kann, eine längere Aufrechterhaltung des Haftbefehls nur deshalb in Kauf zu nehmen, weil der Staat es versäumt hat, seiner Pflicht zur verfassungsgemäßen Ausstattung der Gerichte zu genügen.
Zudem greife eine solche Untersuchungshaftverlängerung tief in die Grundrechte des Betroffenen ein, wodurch eine erhöhte Begründungstiefe seitens der Gerichte zu erwarten ist. Damit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit auch transparent kommuniziert werden kann, bedarf es in dem Beschluss der Haftfortsetzung einer ausführlichen Abwägung zwischen dem Freiheitsgrundrecht des Beschuldigten und dem Strafverfolgungsinteresse der Allgemeinheit.
Diesen Maßstäben genügt der angegriffene Beschluss des Oberlandesgerichts Zweibrücken nicht. Einerseits sei die Haftfortsetzung auf einer falschen Grundlage der Arbeitsüberlastung entschieden worden, andererseits fand zudem keine ausreichend begründete Abwägung zwischen den betroffenen Rechtsgütern statt.
Demnach hat das Bundesverfassungsgericht der Verfassungsbeschwerde stattgegeben und den Beschluss des OLG unter Zurückweisung der Sache aufgehoben. Das Oberlandesgericht musste nun unter Beachtung der vorstehenden Ausführungen erneut über die Haftfortdauer entscheiden (BVerfG, Beschluss vom 20. Dezember 2017 – 2 BvR 2552/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 20.09.2017 konkretisiert, dass auch ein einfaches Pfefferspray, welches im freien Handel erhältlich ist, mindestens als gefährliches Werkzeug nach § 244 Abs. 1 Nr. 1a StGB zu klassifizieren ist. Demnach sei bereits das Mitführen ausreichend, um den Straftatbestand des § 244 StGB zu erfüllen, welcher eine Freiheitsstrafe von 6 Monaten bis zu 10 Jahren vorschreibt.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte verkaufte dem Zeugen im Herbst 2015 etwa 140 Gramm Marihuana auf Kommission. Als Kaufpreis waren 1.200 € vereinbart worden, welche jedoch trotz mehreren Nachfragen nicht beglichen wurden. Der Angeklagte, welcher einen Hang zu übermäßigen Konsum von synthetischen Cannabinoiden entwickelt hat, drohte dem „Schuldner“ sogar, eine Anzeige bei der Polizei aufzugeben, dass dieser den Betrag einfach gestohlen hat. Auch diese bekräftigte Aufforderung führte aber nicht zur Zahlung der 1.200 €.
Der Beschuldigte beschloss, den Kaufpreis persönlich einzufordern. Dabei war ihm bewusst, dass er den aus dem Betäubungsmittelgeschäft herrührenden Geldbetrag nicht mit zivilrechtlichen Mitteln eintreiben könne, sondern ein selbständiges Tätigwerden erforderlich sein würde. Mit einer Dose Pfefferspray bewaffnet tauchte er dann bei dem „Schuldner“ auf und forderte erneut die Zahlung der ausbleibenden Summe. Der Zeuge lehnte ab und sagte, dass er nicht bezahlen werde. Daraufhin schlug der Angeklagte den Geschädigten mit der Faust in das Gesicht und sprühte Pfefferspray in dessen Richtung, ohne diesen allerdings zu treffen. Der Zeuge floh aus dem Zimmer und informierte die Polizei telefonisch über den Vorfall. Der Angeklagte nahm einen Laptop des Zeugen mit (Wert ca. 300 €), welchen er diesem auf Dauer entziehen wollte und flüchtete durch das Fenster.
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen versuchter besonders schwerer räuberischer Erpressung in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung, sowie mit versuchter gefährlicher Körperverletzung und wegen Diebstahls zu der Gesamtfreiheitsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt.
Die Staatsanwaltschaft wandte sich mit einer Revision zum Bundesgerichtshof und forderte die Korrektur des Schuldspruchs in Bezugnahme auf den einfachen Diebstahl nach § 242 StGB.
Dies bestätigte der BGH und nimmt an, dass es sich nicht lediglich um einen einfachen Diebstahl nach § 242 StGB handelt, sondern das Landgericht zu einem Diebstahl mit Waffen gemäß § 244 Abs. 1 Nr. 1a StGB hätte verurteilen müssen. Dies begründeten die Richter aus Karlsruhe wie folgt:
Das Pfefferspray an sich ist ein von § 244 Abs. 1 Nr. 1a StGB erfasstes Tatmittel. Dabei bedarf es keiner Entscheidung, ob es sich um eine Waffe oder ein anderes gefährliches Werkzeug im Sinne des § 244 StGB handelt, da der Inhalt der Dose nach seiner konkreten objektiven Beschaffenheit dazu geeignet ist, dem Opfer erhebliche Körperverletzungen zuzufügen.
Nach den getroffenen Feststellungen ergibt sich, dass der Angeklagte das Pfefferspray während der gesamten Ausführungsphase des Diebstahls am Laptop gebrauchs – und zugriffsbereit bei sich geführt hat. Wäre es zu einem weiteren Zwischenfall gekommen, so hätte er ohne nennenswerten Zeitaufwand, oder Schwierigkeiten zu dem Mittel greifen können, um sich beispielsweise den Erhalt der Beute zu sichern.
Die vorherige Nutzung des Sprays gegen den Zeugen umfasst ein anderes Tatgeschehen der versuchten räuberischen Erpressung und ist in Hinsicht zum Diebstahl des Laptops getrennt zu betrachten.
Letztendlich hob der BGH den Schuldspruch des Urteils vom Landgericht auf und verwies die Sache erneut an die zuständige Strafkammer, welche den Schuldspruch in Verbindung mit der Freiheitsstrafe korrigieren muss (BGH 1 StR 112/17 – 20. September 2017).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der erste Strafsenat des Bundesgerichtshofes musste sich im Herbst 2017 mit der Strafbarkeit des Verkaufs von sogenannten „Legal Highs“ auseinandersetzen. Einem Händler solcher Kräutermischungen wurden illegale synthetische Cannabinoide geliefert, welche er zu Unwissen verkaufte. Dies rechtfertige nach dem BGH noch keine strafrechtlich relevante Handlung.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein Online-Händler vertrieb in seinem eigens-kreierten Online-Shop Kräutermischungen, welche legale synthetische Cannabinoide enthalten. Diese sogenannten „Legal-Highs“ führen zu verstärkten Rauschzuständen und sind meist lediglich für eine bestimmte Zeitspanne legal zu erwerben, bis ihre chemische Struktur identifiziert und vom Gesetzgeber unter das Betäubungsmittelgesetz gefasst wird. Das Gewerbe des Händlers war offiziell angemeldet, zudem informierte er sich vor jeder Lieferung über die aktuelle Gesetzeslage bezüglich der bestellten Kräutermischungen. Falls nach regelmäßigem Zeitablauf eine Kräutermischung verboten wurde, so bestellte er im nächstmöglichen Zeitpunkt eine andere. So verfuhr ebenfalls der Lieferant, welcher regelmäßig die Legalität der Cannabinoide in seinem Sortiment überprüfte und dies bei Verstößen und Änderungen ggf. fliegend wechselte.
Im Oktober 2015 kam es trotz Überwachung der Gesetzeslage dennoch zu einem Verkauf von Kräutermischungen, welche zu diesem Zeitpunkt bereits illegal waren und unter das Betäubungsmittelgesetz fallende synthetische Cannabinoide enthielten. Dies führte dazu, dass die zuständige Staatsanwaltschaft Anklage wegen des Handeltreibens von Betäubungsmitteln erhob.
Das in erster Instanz zuständige Landgericht Heilbronn sprach den Angeklagten frei. Aus Sicht der Richter habe der Händler sich weder wegen vorsätzlichem, noch fahrlässigem Handel mit Betäubungsmitteln strafbar gemacht.
Diese Entscheidung war der Staatsanwaltschaft ein Dorn im Auge, denn aus ihrer Sicht bestand mindestens eine Strafbarkeit bezüglich Fahrlässigkeit vor. Sie legte Revision zum Bundesgerichtshof ein.
Der BGH bestätigte jedoch die Entscheidung des Landgerichts Heilbronn und wies somit die Revision der Staatsanwaltschaft zurück. Selbst ein fahrlässiger Handel mit Betäubungsmitteln sei im vorliegenden Fall nicht zu bejahen. Dies fußt auf folgender Begründung:
Der Angeklagte hätte für eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit eine objektive Sorgfaltspflicht verletzen müssen. Eine Pflicht, die bezogenen synthetischen Cannabinoide für die Kräutermischungen vor deren Verwendung/Herstellung auf ihre chemische Zusammensetzung analysieren zu lassen, bestand jedoch nicht. Allein das Handeln mit synthetischen Cannabinoiden begründe noch keine ausführliche Pflicht eines einzelnen Händlers, die Ware laboratorisch testen zu lassen. Dies würde Kleinhändler finanziell zu stark belasten und eine Unverhältnismäßigkeit der Sorgfaltsmaßnahme begründen.
Der Händler habe vielmehr darauf vertrauen dürfen, dass von seinem stets zuverlässigen Lieferanten keine illegalen Cannabinoide geliefert werden. Obwohl ein generelles Risiko besteht, erwartungswidrig mit Betäubungsmitteln beliefert zu werden, so handelt es sich dennoch solange um eine gesetzeskonforme Tätigkeit, wie die betroffenen Stoffe noch nicht als Betäubungsmittel bestimmt worden sind. Eine Kontrollpflicht könne seitens der Richter des BGH nur in Ausnamefällen angenommen werden, beispielsweise dann, wenn die Unzuverlässigkeit der Bezugsquelle dem Händler bekannt wäre. Dies lag im geschilderten Fall jedoch gerade nicht vor, da der Lieferant stets informiert war und es zuvor noch nicht zu Komplikationen kam (BGH, Urteil vom 20.09.2017 – 1 StR 64/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht