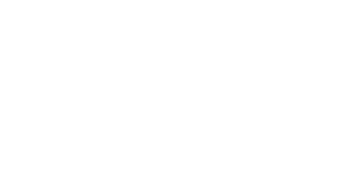Veröffentlichungen

Der Bundesgerichtshof hat im Mai 2021 einen weiteren Betäubungsmittelfall auf rechtliche Fehler geprüft und solche festgestellt. Die Richter aus Karlsruhe verdeutlichten die Schwelle zwischen dem Beginn des Handeltreibens nach § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BtMG bei der Aufzucht von Cannabispflanzen und dem davon nicht umfassten Lagern der Stecklinge.
Der Revision liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Das vorinstanzlich zuständige Landgericht hat ein Ehepaar verurteilt, da diese nach den Feststellungen des Gerichts seit April 2019 damit begonnen haben, in ihrem Eigentumshaus eine Cannabis-Plantage einzurichten, um durch den Verkauf der erwarteten Ernte die notwendigen Mittel für eine Hausrenovierung zu erwirtschaften. Als die Polizei im November 2019 eine Hausdurchsuchung durchführte, wurden 342 Cannabis-Stecklinge mit einer Höhe zwischen 10cm und 15 cm aufgefunden, welche bereits in Steinwolle-Blöcke eingepflanzt waren. Die Stecklinge hatten zum Zeitpunkt des Auffindens einen Wirkstoffgehalt von 3,08 % THC, was bei einer Gesamtmasse von 74,69 Gramm Marihuana eine Gesamtmenge von 2,3 Gramm THC darstellt.
Setzlinge sollten in bereits eingerichtete Pflanzenbänke im Hauptanbauraum eingebettet werden
Die Pflanzen befanden sich in diesem Zeitraum jedoch noch nicht im eingerichteten Anbauraum, sondern wurden im Flur des Hauses zwischengelagert. Im Hauptraum fanden die Beamten 65 eingerichtete Pflanzschalen, in welchen die Stecklinge nach den Vorstellungen der Angeklagten heranwachsen und abgeerntet werden sollten. Im vorliegenden Fall sollte ein Ertrag von ca. 7kg erwirtschaftet werden, welcher einen ungefähren Verkaufswert von 25.000 EUR bedeuten würde.
Das Landgericht hat eine Verurteilung aufgrund des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge nach § 29 Abs. 1 Nr. 2 BtMG angenommen, da nach Ansicht der Richter die Setzlinge bereits einen hohen THC-Gehalt aufwiesen und zudem in räumlicher Nähe zu den Pflanzbänken aufbewahrt wurde, so dass diese bereits im weiteren Sinne in die Plantage eingebracht wurden.
Wann liegt die Vollendung des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln bei Stecklingen vor?
Die Beschuldigten legten Revision zum Bundesgerichtshof ein, welche teilweise erfolgreich war.
Nach der gesetzlichen Definition ist ein Handeltreiben wie folgt zu definieren:
Handeltreiben im Sinne des 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BtMG ist jede eigennützige auf den Umsatz von Betäubungsmitteln gerichtete Tätigkeit (BGH, Beschluss vom 26. Oktober 2005 – GSSt 1/05, BGHSt 50, 252, 256). Hiervon sind solche Handlungen abzugrenzen, „die lediglich typische Vorbereitungen darstellen, weil sie weit im Vorfeld des beabsichtigten Güterumsatzes liegen“ (BGH, aaO, 265 f.). Dabei ist auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalles abzustellen.
Im vorliegenden Fall argumentierten die Richter aus Karlsruhe, dass ein alleiniger Erwerb der Setzlinge zum Zweck des anschließenden Anbaus noch keine auf den Umsatz von Betäubungsmitteln gerichtete Tätigkeit darstellt, welche für eine Verurteilung nach diesem Straftatbestand notwendig ist. Hier ist eine Abgrenzung zwischen dem Tatbestand des Anbaus von Betäubungsmitteln trennscharf durchzuführen. Der Versuch ist nach dem Sinn und Zweck des Gesetzgebers erst dann zu bejahen, wenn ein unmittelbares Ansetzen zur Aussaat oder zum Anpflanzen erkenntlich ist.
Das Ansetzen zum Anbau der Pflanzen kann man in der Zwischenlagerung der Stecklinge vor der Hauptkammer nicht eindeutig als Versuch einordnen. Nach Ansicht des Generalbundesanwaltes ist hier auch eine Auslegung als Verbrechensverabredung möglich. Eine Vollendung des Handeltreibens, wie es das vorinstanzliche Landgericht hier gesehen hat, ist nach Ansicht der Richter aber erst eingetreten, wenn der Anbau mit Verkauf – und Gewinnerzielungsabsicht begonnen wurde, demnach mit dem Anpflanzen der Stecklinge in einer bestimmten Mindestgröße in die dafür vorgesehenen Pflanzenboxen.
Das ist im obig geschilderten Fall nicht eingetreten, demnach kann eine Vollendung hier nicht angenommen werden.
Die Sache wurde zur erneuten weiteren Feststellung an eine andere Strafkammer des vorherigen Landgerichts zurückverwiesen.
BGH, Beschl. v. 27.05.2021 – 5 StR 337/20
AdobeStockFoto-Nr.: 261123172
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Die Corona-Pandemie wütet nun bald schon seit zwei Jahren in Deutschland und auch die Justiz muss sich mit dieser neuen Infektionskrankheit auseinandersetzen. Dies hat man im Herbst 2021 vermehrt festgestellt, dort wurden nämlich zahlreiche Arztpraxen durchsucht und Patientenakten beschlagnahmt, da die Staatsanwaltschaften vermehrt Hausärzte ins Visier nehmen, welche verdächtigt werden, unrichtige Gesundheitszeugnisse auszustellen, was nach § 278 StGB strafbar ist.
Ursprung dieser Behauptung seitens der Staatsanwaltschaft sind meist vermehrte Kontrollen durch die Polizei bei Personen, welche ohne medizinische Maske in Bereichen angetroffen werden, in welchen eine Maskenpflicht herrscht. Das ist weitgehend im aktuellen Zeitpunkt im Einzelhandel, der Gastronomie und den öffentlichen Verkehrsmitteln vorgeschrieben und wird bei Nichtbeachtung mit einer Geldbuße geahndet.
Aufgrund vermehrter Kontrollen wurde dieses Phänomen bekannt
Da viele aufmerksame Bürger solche Missachtungen dieser Fälle beobachten und auch bei der zuständigen Polizeibehörde melden, kommt es häufiger zu Kontrollen seitens der Polizei. Manche Passanten können ihren Verstoß jedoch mit einem sogenannten „Corona-Attest“ rechtfertigen. Das sind Atteste, welche durch einen Mediziner ausgestellt werden können und den Patienten somit von der Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes befreien. Die Personen können sich dann in Bereichen ohne Maske bewegen, ohne Angst vor einem Bußgeld zu haben.
Wie ist der Gesundheitszustand dieser Personen wirklich?
Fraglich ist jedoch, ab welchen gesundheitlich festgestellten Problemen ein solches Attest ausgestellt werden kann. Die medizinische Notwendigkeit eines solchen Attestes für eine Maskenbefreiung ist eine Frage, welche zwischen Arzt und Patienten geklärt wird. Der Gesetzgeber hat in seiner Verordnung keine Konkretisierungen von Ausnahmefällen genannt – die Länder haben in ihren Satzungen keiner solcher Fälle festgelegt.
Aufgrund der Häufung dieser Fälle bei vermehrten Polizeikontrollen an solchen maskenpflichtigen Orten des täglichen Lebens kamen viele Ärzte in Verruf. Die Staatsanwaltschaften sahen hier eine Art Schlupfloch des Bürgers, sich gegen die auferlegten Pflichten zu wehren.
Den Ärzten wurde derweil vorgeworfen, dass sich diese zu schnell zu einem „Masken-Attest“ überreden lassen und selbst Patienten ein solches ausstellen, bei welchem es gesundheitlich keiner Notwendigkeit bedarf. Dies führte sogar zu solchen Umständen, dass bei Hausärzten, welche besonders viele solcher Atteste ausgestellt hatten, Hausdurchsuchungen in ihren Praxen durchgeführt wurde, um Beweise für angeblich falsche Corona-Atteste zur Maskenbefreiung zu erheben.
Glücklicherweise gilt es in diesem Fall seitens der Exekutive, das strafrechtliche Verhalten der Ärzte zu beweisen. Dies gelingt in solchen Fällen lediglich selten, da die Verbindung zwischen Arzt und Patienten im deutschen Recht sehr schutzwürdig gestaltet ist und der Arzt nicht verpflichtet ist, eine Vortäuschung der Symptome des Patienten in irgendeiner Art und Weise zu kontrollieren.
Durch diese Konstellation macht der Arzt sich lediglich strafbar, wenn er Kenntnis von den vorgetäuschten Symptomen / Fehlinformationen seines Patienten hat und diesem trotzdem ein solches Attest ausstellt.
Dies konnte jedoch in keinen der oben genannten Fälle nachgewiesen werden, was zur Einstellung der Verfahren führte.
AdobeStock Foto-Nr.: 348825283
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das Amtsgericht Reutlingen hatte sich Anfang des Jahres mit einem deutschen Rechtsgrundsatz auseinanderzusetzen. Es geht vorab um die Zulässigkeit der Vollstreckung einer Geldstrafe.
Zum Sachverhalt:
Bei dem Verurteilten wurde durch die Mitbewohner des Hauses ein verstärkter Cannabisgeruch festgestellt, so dass diese die Polizei alarmierten. Nachdem sich die Beamten im Haus eingefunden haben und den Geruch problemlos feststellen konnten, forderten Sie eine richterliche Anordnung zur Kontrolle der Wohnung an, worauf es zum Auffinden von Betäubungsmitteln und einer Auseinandersetzung zwischen dem noch damals Verdächtigen und einem Polizeibeamten kam. Dies geschah am 02.04.2021.
Strafbefehl wegen Besitz von Betäubungsmitteln vom 07.05.2021
Der erste Strafbefehl, welcher den Besitz der Betäubungsmittel sanktionierte, stammt vom 07.05.2021. In diesem wurde der Beschuldigte zu einer Geldstrafe verurteilt. Gegen diesen Strafbefehl legte der Mann Einspruch ein – die Sache wurde vor dem Amtsgericht Reutlingen verhandelt. Es kam am 26.06.2021 zu einem Urteil, welches mit dem Strafbefehl übereinstimmte.
Hauptverhandlung aufgrund Widerstandshandlung gegen Polizeibeamten vom 29.07.2021
Des weiteren kam es aufgrund der Widerstandshandlung gegen den Beamten zu einer Hauptverhandlung am 29.07.2021.
Die Staatsanwaltschaft, welche beide Taten separat verfolgt, hat einen Antrag gestellt, dass eine Vollstreckungshandlung aus dem Urteil vom 26.06.2021 und dem damit verbundenen Strafbefehl vom 07.05.2021 unzulässig sei, da es gegen das verfassungsrechtliche Verbot der Doppelbestrafung, welches in Art. 103 III GG verankert ist, verstoßen würde.
Über die prozessuale Tat, welche nach Ansicht des Amtsgerichts Reutlingen in Tateinheit, § 52 StGB begangen wurde, ist bereits in der Verhandlung entschieden worden. Eine Wiederaufnahme des Verfahrens ist nicht geboten und wurde auch nicht vom Verurteilten beantragt.
Nach Ansicht des Richters ist der Sachverhalt weder rechtlich noch bei verständiger Betrachtung des Geschehens in der Gesamtsituation in irgendeiner Art und Weise aufspaltbar. Somit gehört das vollumfängliche Verhalten des Angeklagten zu einem einheitlichen Lebensvorgang.
Der Richter nutzte folgenden Wortlaut:
„Dass die gesamte Tat bereits rechtskräftig abgeurteilt ist, war wohl bedauerlicherweise zu übersehen, da in dem Bundeszentralregisterauszug (Stand: 28.04.2021, mit Beantragung des Strafbefehls im Juni) in der Verfahrensakte in Sachen 5 Cs 24 Js 7842/21 die frühere Aburteilung durch den Strafbefehl noch nicht enthalten war und vom zum damaligen Zeitpunkt unverteidigten Angeklagten in der Hauptverhandlung am 29.07.2021 nicht mitgeteilt wurde. Lediglich anzumerken bleibt, dass die eingesetzte Software ForumStar nicht auf die Anhängigkeit von mehr als einem Verfahren zur gleichen Zeit gegen ein und dieselbe Person beim Gericht oder Spruchkörper automatisiert hinweist. Dar er Strafbefehl. welcher zur zweiten Verurteilung führte, beim Gericht erst im Juni 2021 beantrag: wurde, hat sich das Fehlen einer entsprechenden Softwarefunktion nicht ausgewirkt.“
Die doppelte Verurteilung ist misslich, rechtswidrig und wurde erst mit einer vorzunehmenden Gesamtstrafenbildung bei der Staatsanwaltschaft augenfällig.
Von Amts und Verfassungs wegen ist die „zweite Geldstrafe” nicht zu vollstrecken, wenn auch der „doppelt” Verurteilte den Fehler weder bis zur Rücknahme einer Berufung noch zu einem späteren Zeitpunkt gerügt hat.”
Hier kam es zu dem seltenen Fall, dass die Staatsanwaltschaft eingeschritten ist und es dadurch zu einem besseren Ergebnis für den Verurteilten führte.
AG Reutlingen, Beschl. v. 25.01.2022 – 5 Cs 24 Js 7842/21
AdobeStockFoto-Nr.: 127846565
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das Oberlandesgericht Karlsruhe musste sich gegen Ende des Jahres 2021 mal wieder mit einem „typischen“ Corona-Fall sowie dessen Rechtmäßigkeit beschäftigen. Ein Mann habe sich im öffentlichen Raum zu I. in einer „spontanen“ Versammlung wiedergefunden und hat dabei das Gebot der Maskenpflicht verletzt, indem er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Dies führte zu einem Bußgeldbescheid in Höhe von 600 EUR, welcher laut den Richtern des OLG Karlsruhe rechtskräftig sei. Zudem kam es zu einem späteren Zeitpunkt zu einer Kontrolle in einer Fußgängerzone, in welcher der Mann ohne Alltagsmaske unterwegs war, was wiederum zu einem Bußgeldbescheid von 70 EUR führte. Auch diese Sanktion war für die Richter des Oberlandesgerichts schlüssig.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Zu I. Der Beschuldigte habe sich am 15.04.2020 mit weiteren Protestanten vor dem Dienstgebäude der Kriminalpolizeidirektion H. versammelt, um Solidarität mit einer getrennt verfolgten Rechtsanwältin zu bekunden, welche um 13:00 in dem genannten Gebäude zu einem Vernehmungstermin geladen wurde.
Zwischen 13:00 Uhr und 14:00 Uhr kam es deswegen zu einer Ansammlung von ca. 150 – 200 Menschen, welche dicht zusammengedrängt vor dem Gebäude protestierten. Die Polizei hat durch zwei Lautsprecherdurchsagen darauf hingewiesen, dass es sich bei der vorliegenden Bekundung um eine nicht genehmigte und gemäß der Corona-Verordnung auch nicht genehmigungsfähige Versammlung handele, und hatte die Auflösung der Versammlung angedroht.
Durch diese Durchsagen betonte das Amtsgericht in seiner Feststellung, dass dem Beschuldigten spätestens zu diesem Zeitpunkt klar war, dass er durch sein Verhalten und dessen Fortsetzung gegen das Aufenthaltsverbot nach § 3 Abs. 1 Satz 1 der Corona-Verordnung des Landes verstößt. Durch sein weiteres Verweilen an der Örtlichkeit wurde dies als Vorsatz gewertet.
Zu II.: Zu einem späteren Zeitpunkt wurde der Beschuldigte in einer Fußgängerzone, in welcher eine allgemeine Maskenpflicht herrschte, kontrolliert. Da aufgrund der Anzahl der Personen ein Mindestabstand von 1,5 Metern auf der Einkaufspassage tagsüber nicht eingehalten werde konnte, kam es dort auf Grundlage einer Corona-Verordnung zu einer Verpflichtung zum Tragen einer Alltagsmaske zu bestimmten Uhrzeiten.
Er legte Einspruch gegen beide Bescheide ein, diese wurden zusammen vor dem Amtsgericht verhandelt, wobei er unterlag.
Gegen dieses Urteil wandte sich der Beschuldigte mit einer Rechtsbeschwerde, da er der Auffassung war, dass die zu den Tatzeiten gültigen Corona-Verordnungen verfassungswidrig waren und das Aufenthaltsgebot – sowie das Abstandsgebot weder erforderlich noch geeignet waren, um die Bekämpfung der wallenden Pandemie einzudämmen.
Die Richter des Oberlandesgerichts Karlsruhe haben sich in detaillierter Tiefe mit der Vereinbarkeit dieser Regelungen hinsichtlich der Verfassungsmäßigkeit auseinandergesetzt und vollumfänglich dessen Erforderlichkeit und Geeignetheit zur Bekämpfung des Pandemiegeschehens bejaht. Die Verordnungen waren zu den Tatzeitpunkten sowohl formell als auch materiell verfassungsgemäß.
Jedoch konnte der Beschuldigte hinsichtlich seiner Geldbuße zu I. von 600 EUR einen Teilerfolg feiern. Dieses wurde von den Richtern als zu hoch angesehen und auf 250 EUR herabgestuft, da ein Vorsatz bei der Versammlung nicht lückenhaft bewiesen werden konnte.
OLG Karlsruhe, Beschl. v. 21.12.2021 – 2 Rb 37 Ss 423/21
AdobeStockFoto-Nr.: 435476649
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Der Bundesgerichtshof musste sich kurz vor den Feiertagen im Jahr 2021 noch einmal mit einem Fall zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr beschäftigen. Das vorinstanzlich zuständige Landgericht hat den Angeklagten wegen vorsätzlichen Eingriffs in den Straßenverkehr nach § 315 StGB verurteilt. Das reichte der Staatsanwaltschaft jedoch nicht, welche der Ansicht war, dass das Landgericht den Tötungsvorsatz des Beschuldigten verkannt hat. Die Richter des Bundesgerichtshofes haben die einzelnen Tathandlungen separat betrachtet und in keinem der Abläufe einen potentiellen Tötungsvorsatz gesehen, die Revision wurde abgewiesen.
Das Landgericht hat folgende Feststellungen getroffen:
Der Beschuldigte habe sich noch bei Tageslicht auf einer Brücke aufgehalten, welche circa sieben Meter hoch ist und den Übergang für eine Bundesstraße darstellt. Plötzlich griff er in das Kiesbett, welches sich neben dem geteerten Übergang der Brücke befand und nahm eine Hand voll scharfkantiger Schottersteine mit unterschiedlicher Größe auf. Die folgenden Untersuchungen ergaben, dass es sich um Steine in einer Größe zwischen 3-7cm handelte und diese Menge ein Gesamtgewicht von ca. 470g aufwies.
Werfen von Kieselsteinen – ist da schon ein Tötungsvorsatz konstruierbar?
Diese Hand voll Kieselsteine hat er dann auf einen PKW geworfen, welcher soeben die Bundesstraße unter ihm befahren hat. Er habe in diesem Moment Wut und Frust auf seine Mitpatienten einer stationären Alkoholentwöhnungstherapie gespürt und durch diese Aktion Druck abgelassen. Er wollte mit dem Wurf der Steine lediglich das Autodach treffen und durch die damit einhergehende Sachbeschädigung eines fremden Gegenstandes seine Aggressionen abbauen.
Das Landgericht geht in keinem Fall davon aus, dass der Beschuldigte durch den Wurf mit diesen oben genannten Steinchen einen Menschen töten, verletzen oder gefährden wollte. Hätte er diese Absicht innegehabt, so wäre es ihm möglich gewesen, größere Steine für seine Tat zu benutzen, welche sich ebenfalls in dem Kiesbett auf der Brücke befanden.
Durch die herabfallenden Steine ist bei dem besagten PKW ein Sachschaden von 4.800 EUR entstanden, da das Dach verbeult und verkratzt wurde. Der Betroffene hat den Aufprall der Steine kaum bemerkt, es kam auch zu keinem unkontrolliertem Fahrmanöver durch Erschrecken oder ähnliche Reaktionen.
Staatsanwaltschaft sah eventuelle versuchte Mordhandlung des Beschuldigten
Die Richter des Bundesgerichtshofes haben sich mit dem genauen Ablauf der Tat sowie den damit verbundenen Schäden sowie den Hauptmotiven des Täters intensiv auseinandergesetzt und sind zu dem Entschluss gekommen, dass hier von einer Absicht des Herbeiführens von Personenschaden und Sachschaden scharf abzugrenzen ist.
Damit § 315b StGB verwirklicht ist, bedarf es einer verkehrsspezifischen Gefahr, auf welche der Täter seinen Vorsatz richtet. Nach den Feststellungen des Landgerichts kam es dem Beschuldigten im obigen Fall jedoch nicht darauf an, einen Unglücksfall auszulösen. Er wollte lediglich das Autodach zerbeulen und keine Massenkarambolage provozieren.
Die Revision wurde abgewiesen, da dies jedoch zum Vorteil des Angeklagten geschah, folgte eine Verweisung zur Neuverhandlung an eine andere Kammer des vorinstanzlichen Landgerichts.
BGH, Beschl. v. 09.12.2021 – 4 StR 167/21
AdobeStockFoto-Nr.: 33190426
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Der Bundesgerichtshof hat sich im letzten Jahr mit einer strafrechtlichen Entscheidung und der Problematik der Zurechnung von Verletzungen sogenannter „Berufsretter“ auseinandergesetzt. Durch eine Explosion und einen damit verbundenen Brand kamen zwei Feuerwehrleute ums Leben, da Sie eine Gefahr einer Explosion in der konkreten Situation verkannt hatten. Die Richter des Bundesgerichtshofes gehen in diesem Urteil so weit, dass Sie dem Beschuldigten den verursachten Tod sowie die damit zusammenhängenden Körperverletzungen der Berufsretter erfolgreich zurechnen.
Dem Beschluss der obersten Revisionsinstanz liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte hatte als Arbeiter eines Subunternehmers auf dem Werksgelände der BASF SE in Ludwigshafen sogenannte „Dehnungsbögen“ von Rohrleitungen demontiert, welche im Nachhinein ausgetauscht werden sollten. Damit diese abgebaut werden können, wird die zu bearbeitende Rohrleitung „stillgelegt“. Im Anschluss werden die darunter liegenden Leitungen mit einem Trennschleifer zersägt.
Verwechslung der Leitung führte zu schwerwiegenden Folgen
Im vorliegenden Fall wurden die Umbauarbeiten wie folgt geplant: Zwei Mitarbeiter des Werkes liefen die zu bearbeitenden Rohrleitungen ab und markierten diese mit einem X, damit Sie vom eingesetzten Subunternehmer auch ausreichend identifiziert werden können. Bedauerlicherweise verwechselte der Handwerker jedoch die betreffende Leitung versehentlich mit der benachbarten Rohrleitung, in welcher zum Zeitpunkt des Fehltrittes immer noch hochentzündliches Gas geführt wird. Nach dem Ansetzen des Trennschleifers verursachte der Funkenflug eine Explosion, da sich das in der Rohrleitung geführte Gas entzündet hat.
Zwei Explosionen raubten vier Feuerwehrleuten der Werksfeuerwehr das Leben
In Folge dieser Explosion strömte weiter Gas aus. Nach ca. 10 Minuten haben sich bereits mehrere Feuerwehrleute der Werksfeuerwehr an der Unfallstelle versammelt. Obwohl sich die Berufshelfer an den Mindestabstand von 50 Metern zur Brandstelle gehalten haben, kam es aufgrund der ansteigenden Hitze um die Rohrleitungen zu einer weiteren, größeren Explosion, welche vier Feuerwehrleuten das Leben kostete.
Ein daraufhin durchgeführtes Gutachten ergab, dass die Feuerwehrleute im Zeitpunkt der Annäherung die äußere Erhitzung der Fernleitung nicht objektiv erkennen konnten und demnach die hohe Explosionsgefahr nicht wahrnahmen.
Das erstinstanzliche Landgericht verurteilte den Subunternehmer, welcher den Unfall überlebte, aufgrund fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und wegen fahrlässigen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Dagegen wandte sich der Beschuldigte mit einer Revision zum Bundesgerichtshof. Die Richter aus Karlsruhe haben diese jedoch verworfen. Nach ihrer Ansicht habe der Beschuldigte eine Gefahrenquelle herbeigeführt, für welche eine Gefahrenbekämpfung notwendig war.
Als die Feuerwehrleute die Brandstätte erreichten, führte diese Gefahrenbekämpfung unmittelbar zum Tod der Berufshelfer. Diese haben sich an die objektiven Vorschriften des Mindestabstandes gehalten – die zweite Explosion war auch nicht vorhersehbar. Im vorliegenden Fall hat der BGH die strafrechtliche Zurechnung bejaht – Das Urteil des Landgerichts hat demnach Bestand.
BGH, Beschl. v. 05.05.2021 – 4 StR 19/20
AdobeStockFoto-Nr.: 79049561
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das Kammergericht musste sich im August 2021 damit auseinandersetzen, ob das unentschuldigte Fernbleiben in einer gerichtlichen Hauptverhandlung aufgrund eines Erstkontaktes mit einer corona-infizierten Person Konsequenzen nach sich zieht.
Der Betroffene hat Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt, welche nach § 74 Abs. 2 OWiG nur vom Tatgericht verworfen werden darf, wenn der Betroffene ohne genügende Entschuldigung ausgeblieben ist. Dies sah er jedoch anders. Durch den Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person sei es für ihn selbstverständlich, nicht bei Gericht zu erscheinen. Diesen Vortrag ließ das zuständige Amtsgericht nicht gelten.
Gegen diese Entscheidung legte der Betroffene Beschwerde zum Kammergericht ein. Er begründete seine Verfahrensrüge damit, dass durch die Verwerfung des Einspruches gegen den Bußgeldbescheid sein Anspruch auf rechtliches Gehör nach Art. 103 Abs. 1 GG verletzt wurde.
Das Kammergericht folgte der Meinung des Amtsgerichtes und stellte fest, dass der Richter den Einspruch nach § 74 Abs. 2 OWiG rechtsfehlerfrei verworfen hat, somit die Kontaktpersoneigenschaft ohne Mitteilung nicht zu dem Privileg führt, bei einer gerichtlichen Hauptverhandlung einfach fernzubleiben.
Der Kern der Entscheidung liegt in der Reichweite der Nachforschungspflicht
Verfahrensrechtlich trifft den zuständigen Richter eine Nachforschungspflicht über einen Entschuldigungsgrund, wenn ein Angeschuldigter bei der Hauptverhandlung nicht anzutreffen ist. Dazu zählen im Einzelfall abzuwägende Belange des Betroffenen, welche gegen die öffentlich – rechtliche Pflicht zum Erscheinen in der Verhandlung abgewogen werden müssen. Kommt der Richter zu dem Entschluss, dass es sich um einen triftigen Grund des Fernbleibens handelt, so ist ein Einspruch stattzugeben.
Zu Beginn prüft der Richter jedoch, ob eine Entschuldigung des Angeklagten überhaupt vorliegt – erst folgend wird geprüft, ob diese Entschuldigung auch ausreichend sei.
Die oben genannte Nachforschungspflicht des Vorsitzenden Richters tritt erst dann ein, wenn ein „konkreter und schlüssiger Sachvortrag vorliegt“, welcher das Ausbleiben des Betroffenen im Kern umreißen kann.
Schriftsatz der Verteidigung vor Sitzungsbeginn reichte in diesem Fall nicht aus
Hier wurde das Ausbleiben des Beschuldigten durch seine Verteidigerin vor Sitzungsbeginn durch einen Schriftsatz dem Gericht preisgegeben. Es wurden Angaben zur Kontakteigenschaft sowie zum positiven Testergebnis der erkrankten Person mitgeteilt. Dies war seitens des Kammergerichts zu vage und zu unpräzise. Es bedürfe einem „gerichtlich überprüfbaren“ Dokument über die tatsächliche Erkrankung der Kontaktperson sowie detaillierte Infos zum Ort und Zeit der Testung. Auf eine bloße Behauptung müsse sich das Amtsgericht nicht einlassen.
Zudem wurde vom Kammergericht klargestellt, dass der Schriftsatz keine Nachforschungspflicht des Richters auslöst – da das Schreiben keinerlei auf Wahrheitsgehalt überprüfbaren Angaben enthielt.
Ein nachträglich eingereichter Schriftsatz der Verteidigung war im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht von Bedeutung, da es hier hinsichtlich der rechtlichen Überprüfung des Verwurfes des Einspruchs auf die Umstände allein ankommt, welche dem Gericht bei erlass des Urteils bekannt waren oder hätten bekannt sein müssen.
KG, Beschl. v. 30.08.2021 – 3 Ws (B) 163/21
AdobeStockFoto-Nr.: 333905146
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das Landgericht Oldenburg hatte im Februar 2022 eine klassische Fallgestaltung zum Zeugnisverweigerungsrecht von Eheleuten zu entscheiden, welches sich aus § 52 Abs. 1 Nr. 2 StPO herleiten lässt.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein Ehepaar habe sich im eigenen Haus gestritten, der Mann soll an diesem Abend sogar handgreiflich geworden sein. Um den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen, entschied der Mann, das Haus zu verlassen. Er wählte das Auto – Problematisch war jedoch, dass er zuvor eine ordentliche Menge Alkohol getrunken hat und zum Zeitpunkt des Wegfahrens absolut fahruntüchtig war.
Die Ehefrau wollte ihrem Ehemann schaden und hat deshalb die Wegfahrt des Mannes mit dem PKW der örtlichen Polizeidienststelle gemeldet. Die Beamten fanden den Mann einige Straßen in der Wohnung seiner Eltern – im Zustand der absoluten Fahruntüchtigkeit.
Diese Spritztour führte zu einem amtsgerichtlichen Beschluss des Entzuges der Fahrerlaubnis.
Versöhnung führt zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis
Als das Verfahren vor dem Amtsgericht stattfand, teilte die Frau dem Gericht mit, dass sich Sie und ihr Mann wieder versöhnt haben und Sie für den aktuellen Zeitpunkt von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht.
Aufgrund der Tatsache, dass zum Zeitpunkt des Verfahrens keine weiteren Beweise vorlagen für das Führen eines Fahrzeuges im öffentlichen Straßenverkehr im Zustand der Trunkenheit vorlagen außer die Aussage seiner Ehefrau führte zur Aufhebung des amtsgerichtlichen Beschlusses.
Es mangelt an den Voraussetzungen für einen Entzug der Fahrerlaubnis durch das Amtsgericht. Der Beschuldigte streitet ab, dass Fahrzeug geführt zu haben. Er selbst gab an, dass er von seinem Vater abgeholt wurde.
Diesen Umständen widerspricht zwar die Zeugenaussage der Ehefrau zum Zeitpunkt der Notrufabgabe sowie der Vernehmung am Folgetag der Tat durch die Polizei, diese Aussage kann jedoch nicht mehr rechtmäßig verwertet werden, da die Frau am 13.12.2021 gegenüber der Polizei erklärte, dass Sie sich auf ihr Zeugnisverweigerungsrecht beruft.
Für einen solchen Fall sieht § 252 StPO die Einräumung eines umfassenden Verwertungsverbotes für in Vernehmungen gemachten Angaben der zeugnisverweigerungsberechtigten Zeugin vor.
LG Oldenburg, Beschl. v. 03.02.2022 – 2 Qs 40/22
AdobeStockFoto-Nr.: 240099241
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Der Bundesgerichtshof hat sich im Oktober 2021 erneut mit dem Straftatbestand des § 244 StGB sowie seinen Alternativen auseinandergesetzt. Es stand zur Frage, ob ein im Dachboden platzierter Ersatzschlüssel ein gültiges Tatmittel für den schweren Wohnungseinbruchsdiebstahl nach § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB darstellen kann. Die Richter aus Karlsruhe sahen in diesem Fall die Nutzung eines sogenannten „falschen“ Schlüssels als erfüllt an und lehnten die Revision demnach ab.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Beschuldigte hat nach den Feststellungen des Landgerichts die Haustür zu einem Mehrfamilienhaus aufgehebelt und sich somit unbefugten Zutritt in das Treppenhaus des Hauses verschafft. Danach ging er auf den Dachboden, auf dem ein Ersatzschlüssel für die Privatwohnung hinterlegt war, welche er betreten wollte.
Beschuldigter wusste durch seine Ex-Freundin den Standort des Ersatzschlüssels
Der Angeklagte hatte lediglich Kenntnis über diesen Schlüssel, da seine Ex-Freundin während der Beziehung der Beiden in diesem Haus gelebt hat und dort den Schlüssel des Öfteren aufbewahrte. Ob der Vermieter Kenntnis über den Schlüssel hatte, war in den Feststellungen des Landgerichts nicht vermerkt.
Da die Mietverhältnisse sich jedoch bei Auszug der Ex-Freundin geändert haben und nun neuen Mieter die vollständige Zugriffsmöglichkeit zur Mietwohnung eingeräumt wurde, ist der Schlüssel nach § 244 Abs. 1 Nr. 3 StGB als „falsch“ zu deklarieren, da diesem zum Tatzeitpunkt die Widmung des Berechtigten zur Öffnung des Schlosses fehlte (vgl. BGH, Beschluss vom 18.11.2020 – 4 StR 35/20).
Kenntnis des Vermieters über den Schlüssel spielt zudem eine Rolle
Demnach sind auch nur die Wohnungstürschlüssel zur Öffnung einer Mietwohnung berechtigt, welche den neuen Mietern übergeben wurden und diesen bekannt sind. Wird ein solcher Schlüssel jedoch vom Vermieter ohne Wissen des Mieters zurückgehalten, so wird der Schlüssel, sobald die Wohnung „vermietet“ wird, juristisch „entwidmet“ und darf somit nicht mehr benutzt werden. Gleiches gilt auch, wenn der Vermieter selbst keine Kenntnis mehr über die Existenz eines weiteren Wohnungsschlüssels hat. Dann kommt es zu dem Fall, dass er durch Übergabe der Schlüssel an den neuen Mieter konkludent zum Ausdruck bringt, dass er nur noch im Besitz der Schlüssel war, über welche er Kenntnis hatte.
Zusammengefasst ist der Beschuldigte zwar nicht in die Privatwohnung „eingebrochen“, jedoch hat er sich eines falschen Schlüssels bemächtigt, welcher richtigerweise vom vorinstanzlichen Landgericht auch als ein solcher gewertet wurde. Dies erfüllt den Straftatbestand des § 244 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 4 StGB, weshalb das Urteil der revisionsgerichtlichen Überprüfung standhält.
BGH, Beschl. v. 12.10.2021 – 5 StR 219/21
AdobeStockFoto – Nr.: 201788416
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
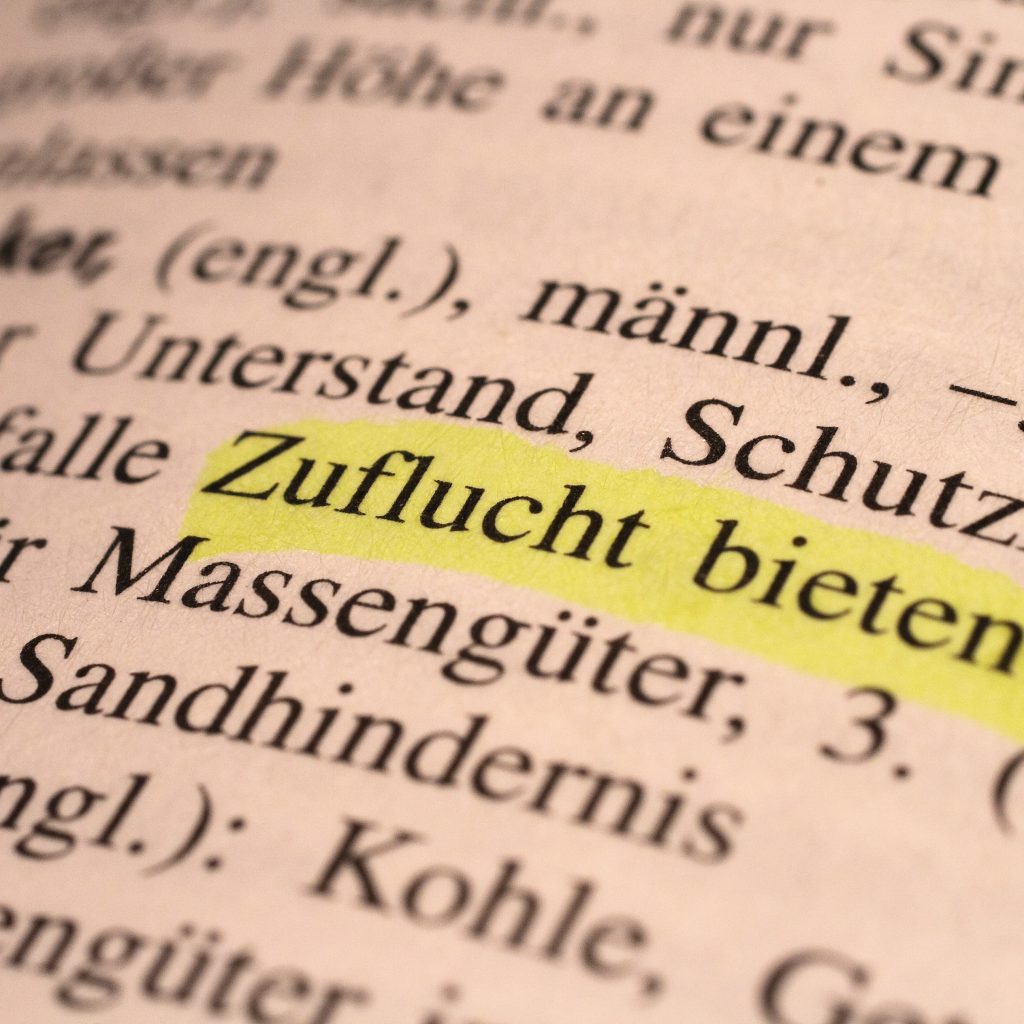
Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat in einem Beschluss aus dem Oktober 2021 mit dem Untersuchungshaftgrund der Fluchtgefahr beschäftigt. Das Gericht musste darüber entscheiden, ob eine Fluchtgefahr bei einem Asylbewerber bestand, welcher als Ersttäter eines einzelnen Diebstahles beschuldigt wurde und sich in einer Erstaufnahmeeinrichtung aufhält.
Die Richter entschieden, dass keine Untersuchungshaft seitens der Staatsanwaltschaft beantragt werden darf. Das Landgericht bestätigte somit die Entscheidung des erstinstanzlichen Amtsgerichtes. Zwar ist davon auszugehen, dass derAsylbewerber in seiner Erstaufnahmeeinrichtung keinen Wohnsitz im Sinne des § 7 BGB begründet hat, dennoch könne der Haftbefehl nicht erlassen werden.
Die von der Staatsanwaltschaft angenommene Fluchtgefahr bedarf bestimmter Tatsachen, welche bei der Würdigung aller Umstande des Falles einen Anschein erzeugen müssten, dass es wahrscheinlicher ist, dass der Beschuldigte sich dem Verfahren entziehen würde, als dass er sich stellen würde.
Erstaufnahmeeinrichtung ist zwar kein Wohnsitz, dennoch ähnelt es einem solchen
Diese Annahme könne man aber, nur weil der Asylbewerber in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht ist, nicht pauschal bejahen. Zwar gilt diese nach dem deutschen BGB nicht als Wohnsitz im Sinne des § 7 BGB, das ist für das Strafverfahren in einer solchen Situation jedoch unerheblich. Vorrangig ist hier, dass eine zügige und geordnete Durchführung des Verfahrens notwendig ist, was jedoch keinerlei Maß an Ortsstabilität verlangt. Es würde eine Hürde darstellen, wenn der Mann obdachlos und beispielsweise nicht auffindbar wäre, auf dem Postweg ist er jedoch durch eine Adresse der Aufnahmeeinrichtung jederzeit erreichbar und somit auch für das Gericht „greifbar“.
Sie halten sich in der Einrichtung nachweislich auf, haben dort Schlafplätze und eigene Spinde. Die Kammer geht aufgrund telefonischer Auskunft der Erstaufnahmeeinrichtung im Übrigen von folgenden tatsächlichen Gegebenheiten aus: Die Bewohner sind dort registriert und bestimmten Zimmern als Wohnplatz zugewiesen. Eingehende Post wird zentral in der Einrichtung gesammelt und erfasst. Bewohner, für die Post eingegangen ist, werden mit Namen in eine aushängende Liste eingetragen. Sie können dann die Post bei der Ausgabe abholen. Wird ein Poststück nach zwei Tagen immer noch nicht abgeholt, sucht der Sicherheitsdienst – gegebenenfalls wiederholt – nach dem Bewohner und informiert ihn persönlich darüber, dass Post für ihn bereitliegt. Wird der Adressat auch nach einer Woche nicht aufgefunden oder angetroffen, geht das Poststück an den Empfänger als unzustellbar zurück.
Somit ist seitens der Justiz ein ausreichender Spielraum vorhanden, den Beschuldigten zu erreichen.
Ein weiterer Einwand seitens der Staatsanwaltschaft, dass die fehlenden sozialen Bindungen im Inland ein Indiz für eine erhöhte Fluchtgefahr darstellen, wurde sowohl vom erstinstanzlichen Amtsgericht als auch vom Landgericht Nürnberg-Fürth abgelehnt.
Letztendlich war die Entscheidung des Amtsgerichts fehlerfrei. Der Haftbefehl wurde rechtmäßig nicht erlassen.
LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. 26.10.2021 – 12 Qs 75/21
AdobeStock Foto-Nr.: 2824589
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht