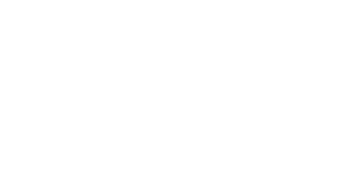Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Auch die ordentlichen Gerichte bleiben von der „Coronawelle“ nicht verschont und müssen sich mit neuartigen Maßnahmen auseinandersetzen, welche in den gerichtlichen Alltag eingreifen und nun rechtlichen Erklärungsbedarf fordern.
Um das Virus weitestgehend einzudämmen, bilden Kontaktverbote und das Prinzip des „Social Distancing“ die Grundsäulen für den Umgang mit dem neuartigen SARS-CoV2-Virus. Demnach ist auch bei Gericht empfohlen worden, etwaige Verhandlungstage bis auf weitere Stabilisierung der gesundheitlichen Situation Deutschlands auszusetzen, oder zu vertagen.
Dies ordnete auch der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Naumburg mit einem Beschluss vom 30.03.2020 an und vertagte die Hauptverhandlung zweier Beschuldigter des gewerbsmäßigen Handelstreibens mit Betäubungsmitteln auf Anfang Oktober 2020, um Gesundheitsgefährdungen entgegenzuwirken. Durch den Aufschub der Hauptverhandlung wurde parallel angeordnet, auch die bereits seit September 2019 andauernde Untersuchungshaft der beiden Angeklagten bis auf Oktober 2020 zu verlängern.
Dagegen wandten sich die beiden Betroffenen mit einer Beschwerde, die angeordnete Untersuchungshaft bis zum neuen Termin im Oktober 2020 auszusetzen. Nach den Vorschriften des §§ 121, 122 StPO darf die Untersuchungshaft ohne ein Urteil nur dann länger als sechs Monate vollzogen werden, wenn die besondere Schwierigkeit, der besondere Umfang der Ermittlungen oder ein anderer wichtiger Grund das Urteil noch nicht zulassen und die Fortdauer der Haft in solch einer besonderen Weise rechtfertigen. Nach Ansicht der Richter des Oberlandesgericht sind diese Voraussetzungen erfüllt, womit die Anordnung der Verlängerung der Untersuchungshaft als rechtmäßig einzustufen ist.
Die Inhaftierten hatten sich auf einen Verstoß gegen das sogenannte „Beschleunigungsgebot“ berufen, welches dem Beschuldigten ein subjektives Recht auf eine schnellstmögliche Abwicklung seines Strafverfahrens einräumt und auf dem Grundsatz des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 EMRK fußt.
Auch dieses Gebot sei trotz Verschiebung der Hauptverhandlungstermine gewahrt worden. Es sei in jedem Einzelfall abzuwägen, ob die Interessen der Allgemeinheit an einer funktionierenden Strafrechtspflege sowie die Interessen des Angeklagten an einer zügigen Erledigung des gegen ihn geführten Strafverfahrens, oder die mit der Durchführung der Hauptverhandlung verbundenen gesundheitlichen Risiken überwiegen. Bei Durchführung der Hauptverhandlung könne in der konkreten Situation nicht garantiert werden, dass das Abstandsgebot eingehalten werden kann und somit die Mitarbeiter der Justiz als auch die Angeklagten mit einem Gesundheitsrisiko behaftet werden, welches das Interesse an der Strafrechtspflege überwiege. Somit entspricht die Neuterminierung dem Beschleunigungsgebot.
Letztendlich wurde die Beschwerde der Inhaftierten verworfen, die Anordnung über die Fortsetzung der U-Haft bis zum neu-terminierten Verhandlungstermin ist demnach rechtmäßig.
Dieser Beschluss zeigt die „Dehnbarkeit“ bestimmter Rechtsbegriffe wie beispielsweise den sonst „engen“ Haftgründen aus §§ 121, 122 StPO, welche der aktuellen Situation angepasst werden und somit auch eventuelle Gefährdungslagen von außen eine Haftfortsetzung rechtfertigen können (OLG Naumburg, Beschluss vom 30.03.2020 – 1 Ws HE 4/20).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Landgericht Osnabrück verurteilte einen 29-Jährigen zu fünf Jahren und drei Monaten Freiheitsentzug aufgrund von betrügerischen Fake-Anrufen zulasten älterer Menschen auf Grundlage des § 263 StGB.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Nach den Feststellungen der Strafkammer handelte es sich um insgesamt fünf Taten, welche seitens des Angeklagten begangen wurden. Während dieser Taten baute der Angeklagte eine Telefonverbindung zu zuvor gezielt ausgewählten Senioren in Deutschland auf, in welchen er sich als ein Beamter der deutschen Polizei ausgibt und gegenüber den Senioren psychischen Druck mit erfundenen Geschichten aufbaut, dass deren gsamtes Vermögen in Gefahr sei. Ziel des Betruges war es, ältere Menschen zur Herausgabe von Bargeld oder Wertgegenständen zu bringen, welche dann von sogenannten „Abholern“ der Bande in Empfang genommen wurden, damit die „Polizei“ diese sicher verwahren könne.
Während zwei Tathandlungen wurden erhebliche Mengen Bargeld als auch Goldschmuck erbeutet. In den drei weiteren Fällen wurde eine Beutesicherung seitens der „richtigen Polizei“ verhindert. Dies wurde durch die Aufmerksamkeit zweier Senioren im Alter von 85 und 88 Jahren ermöglicht, welche die versuchte Betrugsmasche erahnten und unverzüglich die Polizei konsultierten.
Nach zahlreichen Ermittlungen seitens den Behörden wurde der Angeklagte in Griechenland aufgespürt. Dort kam er nach eigenen Angaben mit einer Bande in Kontakt, welche ein eigenes Callcenter in Izmir in der Türkei betreibt und von dort aus die Fake-Anrufe strategisch koordinierte. Nachdem sich der Verdacht erhärtet hat, dass der Angeklagte an der Betrugsmasche beteiligt sein könnte, wurde dieser im März 2018 aufgrund eines deutschen Haftbefehls in Griechenland festgenommen. Im April 2018 wurde er dann nach Deutschland ausgeliefert.
Bereits vor der Hauptverhandlung zeigte sich der Angeklagte geständig und hat eine umfassende Aussage zu den Vorwürfen abgegeben. Des Weiteren hat er einer Kooperation mit den Behörden über zahlreiche Hintermänner und Strukturen des Callcenters zugestimmt, um eine Aufklärung der noch erfolglosen Ermittlungsfälle zu gewährleisten.
Obwohl bei zwei der Taten Bargeldsummen, sowie Goldschmuck mit teils erheblichen Wert erbeutet wurde, ist es fraglich, wieso der Betroffene mit einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren sanktioniert wird, welche nicht auf Bewährung ausgesetzt wurde. Die Höhe des Strafmaßes ergibt sich seitens der Strafkammer des Landgerichts vor allem aus der hohen kriminellen Energie, welche der Täter an den Tag legte. Daraufhin wurden die psychisch-belastenden Folgen der Taten seitens der betroffenen Seniorinnen und Senioren genannt, was zu einer starken Strafschärfung führte.
Zusätzlich wurde noch eine Strafe aus einer früheren Verurteilung bezüglich eines Vermögensdelikts, welches noch nicht vollstreckt worden war, miteinbezogen.
Landgericht Osnabrück, Urteil vom 24.02.2020 – 12 KLs 17/19 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Die Richter des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe mussten sich Anfang 2019 mit der Informationsfreiheit – und Zugang von Strafgefangenen im Vollzug beschäftigen. Diese sei aus Sicht des Gerichts zwar grundsätzlich zu gewährleisten, in einzelnen Fällen sei es jedoch möglich, aufgrund etwaiger Sicherheitsbedenken den Zugang zu Informationstechnik zu untersagen.
Dem Beschluss unterliegt folgender Sachverhalt:
Der Beschwerdesteller ist Strafgefangener in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt und beantragt, dass ihm ein eigener Computer zugewiesen wird, damit er eigene Schriftsätze für gerichtliche Rechtsmittel sowie behördliche Verfahren verfassen kann. Zu diesem Zeitpunkt war es ihm lediglich gestattet, eine zeitlich-beschränkt zugängliche Schreibmaschine für seine Verteidigung zu nutzen.
Die Anstalt verweigerte dem Gefangengen aufgrund etwaiger Sicherheitsbedenken den geforderten Zugang zu einem eigenen Computer und bot als Kompromiss an, eine elektronische Schreibmaschine zur Verfügung zu stellen. Der Gefangene versuchte sein Begehren auf dem Weg der ordentlichen Gerichtsbarkeit geltend zu machen, scheiterte jedoch. Daraufhin legte er Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht ein, da er der Meinung war, dass die ordentliche Gerichtsbarkeit das Gewicht seiner Grundrechte bei deren Ablehnung des Antrages verkannte.
Die Richter aus Karlsruhe entschieden letztendlich gegen den Strafgefangenen. Dies wurde wie folgt begründet: Das Recht eines Gefangenen, in einer bayerischen Strafvollzugsanstalt einen Computer nutzen zu dürfen, unterliegt den gesetzlichen Einschränkungen und sei kein schrankenfreies Recht, welches jedem Insassen vollumfänglich gewährt werden müsse.
Im vorliegenden Fall wäre ein Nutzungsrecht generell einzuräumen, jedoch lag hier gemäß § 72 Abs. 2 Nr. 2 BayStVollzG ein Ausnahmetatbestand vor, da die Überlassung zur Nutzung des Computers im Einzelfall die Sicherheit und Ordnung der Anstalt gefährden könnte.
Den Sicherheitsrisikobegriff füllten die Richter mit den Kriterien, dass es seitens des Inhaftierten bei Zugang jederzeit möglich sei, denn Computer sicherheits – und ordnungsgefährdend zu nutzen. Bezüglich der beispielhaften Nutzung wurden Szenarien wie das unkontrollierte Austauschen von Textinhalten über etwaige Fluchtwege, die Umgehung von Außenkontaktverboten sowie mögliche Aufstellungen über die Abgabe von Betäubungsmitteln an Mitgefangene genannt.
Die Möglichkeit, ein solches Verhalten des Gefangenen durch wiederkehrende Kontrollen seitens des Sicherheitspersonals abzuwenden, wurde vom Gericht aufgrund des damit zusätzlich verbundenen zeitlichen Aufwandes als unverhältnismäßig eingestuft und somit als milderes Mittel verworfen.
Somit wies auch der Bundesverfassungsgerichtshof die Verfassungsbeschwerde als unbegründet ab. Demnach ist es möglich, einem Inhaftierten aufgrund Verdachts der unmittelbarer Gefährdung der Anstaltsordnung den Zugang zu elektronischen Geräten zu untersagen, selbst wenn er diese lediglich für die eigene gerichtliche sowie behördliche Verteidigung benötigt.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 27.03.2019 – 2 BvR 2268/18 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Am Amtsgericht München musste im März 2018 über eine 72-Jährige geurteilt werden, welche ihre Rente durch den ein – bis zweimaligen Verkauf von Marihuana pro Monat aufbessern wollte.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im zugrundeliegenden Verfahren hatte die Seniorin zugegeben, dass sie zwischen Juni 2016 und Juni 2017 in mindestens 24 Fällen in ihrer Wohnung in München Schwabing jeweils 1 Gramm Marihuana zum Preis von 15 Euro verkauft hat, für welches Sie selbst jeweils 10 Euro zahlte. Die angeordnete Wohnungsdurchsuchung am 24. Juni 2017 ergab, dass die Rentnerin 3 Gramm Haschisch in ihrer Wohnung sowie 261 Gramm Marihuana im Keller lagerte, wobei Sie sich vor Gericht einließ, dass etwa ein Drittel der Menge zum Verkauf gedacht war, zwei Drittel jedoch zum Eigenkonsum bestimmt waren, um ihre Appetitlosigkeit eigenhändig zu therapieren.
Bezüglich der aufgefundenen, erhöhten Menge an Bargeld sagte die Seniorin aus, dass dieses nicht etwa aus Drogenverkäufen stammt, sondern aus einer ihr zurückgelassenen, größeren Erbschaft. Sie lebe zurzeit von einer minimal kleinen Rente, welche nicht gänzlich ausreicht, um alle Lebenserhaltungskosten sowie die hohe Miete zu kompensieren, weshalb Sie sich am Verkauf von Betäubungsmittel versuchte. Das Erbschaftsvermögen möchte sich nach eigenen Angaben nicht „verschleudern“. Mit der Vernichtung der sichergestellten Drogen sowie der Beschlagnahme des Verkaufszubehörs war sie einverstanden.
Die Sache flog auf, da ein junger Mann am Flughafen München festgenommen wurde. Dieser hatte eine geringe Menge Cannabis bei sich. Um einer Strafverfolgung zu entgehen, kooperierte er und gab an, dass er über ein Jahr lang ca. ein bis zweimal im Monat je ein Gramm Marihuana bei der Dame gekauft hat. Über die von ihm angegebene Handynummer und Adresse habe die Verurteilte ermittelt werden können.
Die Rentnerin wurde vom Amtsgericht München wegen unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Die Vollstreckung der Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Als Bewährungsauflage wurde der Seniorin eine Zahlung von 2.000 Euro an eine gemeinnützige Organisation aufgegeben, welcher Sie dankend nachging.
Bezüglich der Entscheidungsbegründung äußerte sich die Tatrichterin wie folgt:
Einerseits spreche für die Verurteilte, dass diese sehr geständig war und ohne große Komplikationen mit den Behörden kooperierte. Des Weiteren handelte es sich hier lediglich um den Verkauf von Cannabis, welches als „weiche Droge“ zu bezeichnen ist und ein Großteil davon sichergestellt und vernichtet werden konnte. Zudem soll es sich zum überwiegenden Teil um eine Menge für den Eigenkonsum gehandelt haben, um Appetitlosigkeit sowie die ständige Gewichtsabnahme der Seniorin zu therapieren. Ferner sei die Angeklagte niemals strafrechtlich aufgefallen und zudem schon in einem fortgeschrittenen Alter.
Andererseits wird ihr jedoch zur Last gelegt, dass es sich letztendlich doch um eine große Gesamtmenge des Betäubungsmittels handelt und diese auch nachgewiesen über einen sehr langen Zeitraum von ca. einem Jahr kontinuierlich regen Handel mit den getrockneten Blüten betrieben hat (Amtsgericht München, Urteil vom 27.03.20189:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Ihr Anwalt für Strafrecht
Im Februar 2020 musste sich der VI. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes mit der Halterhaftung von Anhängern gemäß des § 7 Abs. 1 StVG beschäftigen und hat hinsichtlich dieser Norm neue Feststellungen getroffen.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Klägerin hat ihren privaten PKW auf dem Parkplatz der Firma B abgestellt, in welcher ihr Mann als Berufskraftfahrer angestellt ist. Dieser Parkplatz wird überwiegend für die Lagerung von abgekoppelten Sattelauflegern genutzt. Jedoch mündet der Stellplatz in eine öffentliche Straße, wonach die Firma ihren Kunden und sogar außenstehenden Dritten Parkmöglichkeiten einräumt oder es zumindest duldet, dass auch Unbeteiligte ihre Kraftfahrzeuge dort über mehrere Tage abstellen.
Aufgrund des Sturmtiefs „Friederike“ wurde ein in der Nähe abgestellter, bei der Beklagten haftpflichtversicherter Sattelauflieger durch starken Seitenwind gegen den PKW der Klägerin geschoben, der dabei einen Totalschaden erlitt. Der schadensursächliche Sattelauflieger sei nach den Feststellungen der Vorinstanzen nicht ordnungsgemäß gesichert gewesen.
Das Amtsgericht als auch das darauf folgende Berufungsgericht wiesen die Klage mit der Begründung ab, dass der Klägerin ein Anspruch aus § 7 StVG sowie § 115 VVG nicht zustehe, da der Sattelauflieger nicht das Merkmal „bei dem Betrieb“ erfülle, wenn er lediglich auf dem Parkplatz abgestellt wurde. Der Schaden an sich wurde auch nicht aufgrund der Betriebseinrichtung des Auflegers verursacht, sondern lediglich durch äußere, windbedingte Krafteinwirkung.
Auch ein mögliches „Anrollen“ der Räder durch Windeinwirkung reicht laut den Richtern der vorherigen Instanzen nicht aus, da ein solcher Umstand nicht für die Verwirklichung einer typischen Gefahr nach § 7 StVG ausreiche und verwies dabei auf ein Urteil des VI. BGH-Senats aus dem Jahre 2007 (VI ZR 210/06), welches sich mit dieser Problematik befasste.
Diese Argumentationen hielten der Revision in Karlsruhe nicht stand. Der BGH vertritt hier eine andere Form der Halterhaftung nach § 7 Abs. 1 StVG, welche wie folgt zu begründen ist:
Nach der ständigen Rechtsprechung des Senats ist das Haftungsmerkmal „bei dem Betrieb“ im Hinblick auf Kraftfahrzeuge entsprechend dem umfassenden Schutzzweck der Norm weit auszulegen. Die Haftung, welche auf § 7 Abs. 1 StVG fußt, ist der Preis eines jeden Fahrzeughalters dafür, dass er durch das Halten eines eigenen Kraftfahrzeuges eine extreme Gefahrenquelle für seine Mitmenschen schafft. Aufgrund Sinn und Zweck der Norm ist es ratsam, demnach alle möglichen Schadensabläufe, welche durch Kraftfahrzeuge entstehen, in dieser Norm zu erfassen, um einen bestmöglichen Drittschutz zu gewährleisten.
Damit dieses Merkmal jedoch auch Begrenzung erfährt, soll der Betriebsbegriff nur soweit ausgelegt werden, wie der Betrieb eines Fahrzeuges fortdauert, d.h. solange der Fahrer das Fahrzeug im Verkehr belässt und die dadurch geschaffene Gefahrenlage fortbesteht.
Diese Grundsätze, welche der BGH in ständiger Rechtsprechung praktiziert und konkretisiert, sollen auch auf den Betrieb von Anhängern angewendet werden, soweit diese bestimmt sind, von einem Kraftfahrzeug mitgeführt zu werden. Dies sei auch im oben geschilderten Fall zu erwähnen. Durch die starken Windböen kam es zur Gefahr einer unkontrollierten Bewegung des Anhängers, welche letztendlich aus dem vorherigen Betrieb des Anhängers resultierte, welcher dort abgestellt wurde. Der Betriebsbegriff eines solchen Anhängers ist nach Ansicht der Richter aus Karlsruhe erst dann zu verneinen, soweit das Fahrzeug von der Fahrbahn gezogen und an einem Ort außerhalb des allgemeinen Verkehrs aufgestellt wird, was im Kontext so auszulegen sei, dass der Betrieb solange aufrechterhalten wird, bis eine Gefahrenlage für die anderen Verkehrsteilnehmer vollständig ausgeschlossen ist.
Aufgrund der sorgfaltswidrigen Sicherung des Anhängers kam es somit nicht zu einer Aufhebung des Merkmales „bei Betrieb“, wonach die Haftung gemäß § 7 Abs. 1 StVG eröffnet sei und der Klage stattzugeben ist (BGH: Urteil vom 11.02.2020 – VI ZR 286/19).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Amtsgericht Frankfurt am Main hatte sich im Frühjahr 2019 mal wieder mit den Tücken der fortschreitenden Digitalisierung der Kriminalität zu beschäftigen. Dort wandte sich ein Kläger gegen seine Hausratsversicherung, welche sich weigerte, gestohlenes Eigentum aus seinem PKW zu ersetzen, da die Diebe eine neuartige Manipulation der Verriegelungstechnik nutzten.
Das Urteil ergibt sich aus folgendem Sachverhalt:
Dem Kläger wurde von unbekannten Tätern aus seinem geparkten Fahrzeug verschiedene Gegenstände entwendet, welche einen Gesamtwert von ca. 3000 € hatten. Dieses Geld fordert er nun von seiner Hausratsversicherung zurück. Die Problematik ergibt sich daraus, dass die Täter das Auto geöffnet haben, ohne jegliche Aufbruchspuren zu hinterlassen. Nach den Bedingungen der beklagten Versicherung tritt diese jedoch nur ein, wenn der Diebstahl „durch Aufbrechen verschlossener Kraftfahrzeuge“ begangen wurde.
Im Anhang des Versicherungsvertrages findet sich noch eine Klausel, welche das „Aufbrechen“ mit dem „Verwenden falscher Schlüssel“ und dem „nicht ordnungsgemäßen Öffnen mit bestimmten Werkzeugen“ gleichstellt. Dennoch weigert sich die Versicherung, die Schadenssumme auszuzahlen. Der Kläger wandte sich mit einer Leistungsklage an das Amtsgericht Frankfurt am Main.
Der zuständige Richter hat die Klage mit der Begründung abgewiesen, dass der Kläger ein gewaltsames „Aufbrechen“ seines Fahrzeuges, wie es in den Versicherungsbedingungen geschildert wird, nicht nachweisen konnte, da am PKW keinerlei Aufbruchspuren gesichert werden konnten. Eine Ersatzpflicht aufgrund „Einbruchsdiebstahl“ ist somit abzulehnen.
Jedoch könnte aufgrund der offenen Formulierung im Versicherungsvertrag eventuell ein „falscher Schlüssel“ oder ein „anderes Werkzeug zur Öffnung“ benutzt worden sein, welches keinerlei Spuren hinterlassen würde. Diese Umschreibung stellt die sogenannten „Relay-Attack-Diebstähle“ dar. Hierbei fangen die Täter das Funksignal des Autoschlüssels mithilfe eines elektronischen Gerätes ab, um mittels der empfangenen, codierten Schlüsseldaten das Auto zu einem späteren Zeitpunkt ohne Gewahrsam des Schlüssels erneut öffnen zu können. Dadurch, dass die Täter ein Gerät zum Empfangen und auch zum erneuten Senden der Daten an das Auto verwenden, könne darin ein „Werkzeug“ zur „nicht-ordnungsgemäßen Öffnung“ des PKW gesehen werden, womit eine Ersatzpflicht nach dem Versicherungsvertrag eintreten kann.
Der Klage könne jedoch auch aufgrund dieser These nicht stattgegeben werden, da der Kläger zu keinem Zeitpunkt den Nachweis darüber führen konnte, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt der „Relay-Attacke“ jemals tatsächlich verschlossen wurde, beispielsweise durch das typische Schließgeräusch eines PKW oder das Aufleuchten der Blinklichtanzeige.
Letztendlich könnten sich die Diebe ja auch Zugang zum Auto verschafft haben, indem Sie einen sogenannten „Jammer“ benutzt haben, welcher beim Augenblick der Schließung des Wagens aktiviert wurde und jeglichen Funkverkehr zwischen Fahrzeug und Fahrzeugschlüssel unterbrochen hat. In diesem Fall wäre das Auto niemals verschlossen worden. Dann ergibt sich jedoch das Problem, dass die Eintrittspflicht der Versicherung nach dem Versicherungsvertrag von vorneherein ausgeschlossen ist, denn diese tritt lediglich ein, wenn das Fahrzeug verschlossen wurde.
In diesem Urteil ist ersichtlich, wie viele Komplikationen sich in einer einfachen Schadensmeldung für eine Versicherung verstecken können (Urteil vom 18.02.2019 – Amtsgericht Frankfurt am Main).
Falls auch Sie in eine Versicherungsstreitigkeit verwickelt sind, ist es ratsam, einen Rechtsexperten auf diesem Gebiet zu betrauen, um ihre Chancen auf Erhalt der Ersatzleistung zu erhöhen
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Kammergericht in Berlin hatte im Dezember 2019 eine interessante Kombination aus dem Versicherungsrecht als auch aus dem Strafrecht zu bescheiden. Ein „Bestohlener“ ging gegen seine Versicherung vor, weil diese die entwendete Armbanduhr nicht bezahlen wollte. In dem zugrundeliegenden Versicherungsvertrag wurde festgelegt, dass lediglich Raubhandlungen von dieser abgedeckt seien, einfache Diebstahlshandlungen jedoch nicht. Letztendlich liegt bei mangelndem bewussten Widerstand kein versicherter Raub vor.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Kläger schloss nach Kauf einer Armbanduhr eine Versicherung für diese ab, welche bei fahrlässig hervorgerufenen Schäden als auch bei besonderen Fremdeinwirkungen, beispielsweise bei Raub durch einen Dritten, eine Ersatzleistung garantieren soll. Eines Tages war der Kläger in einem Park unterwegs, als er bemerkte, dass „etwas“ einen „Zug“ an seinem Arm hervorgerufen hat. Als er das Gefühl verspürte, zog er den Arm reflexartig nach hinten. Zu dieser Zeit hat ein Dritter jedoch bereits die Armbanduhr vom Handgelenk gelöst und die angehende Flucht ergriffen.
Unverzüglich meldete der Kläger den Vorfall bei seiner Versicherung. Dieser reicht die Beschreibung des Vorfalles durch den Vertragspartner jedoch nicht aus, um eine versicherte Raubhandlung anzunehmen. Somit sah die Versicherung sich nicht in der Pflicht, einzutreten.
Der Kläger wandte sich mit einer Leistungsklage an das Landgericht Berlin, um die Auszahlung der Ersatzsumme zu erreichen. Die Richter des LG zweifelten jedoch an dem genauen Tatgeschehen und wiesen die Klage ab.
Daraufhin legte der Kläger Berufung zum Kammergericht Berlin ein. Dort machte dieser gemäß § 513 Abs. 1 ZPO geltend, dass die Entscheidung des Landgerichts auf einer Rechtsverletzung nach § 546 ZPO beruhe, andererseits bestehen noch weitere Tatsachen, welche eine andere Entscheidung nach § 529 ZPO rechtfertigen. Jedoch konnte auch er die Richter des Kammergerichts nicht von seiner Auffassung der Abwehrhandlung überzeugen, weshalb auch diese die Klage abwiesen.
Der Kläger konnte durch seine Einlassung nicht glaubhaft machen, dass er im konkreten Zeitpunkt, als er das „ziehen“ am Handgelenk verspürte, sofort eine Abwehrhandlung vorgenommen hat, welche dann als „Widerstandshandlung“ ausgelegt werden kann, um die Wegnahme der Sache zu erleichtern und den Tatbestand des § 249 Abs. 1 StGB zu öffnen. Der Kläger habe vielmehr in diesem Moment noch nicht bewusst registriert, dass seine Armbanduhr das Objekt des Zugriffes war, was eher ein Indiz dafür sei, dass er die Wegnahmehandlung kaum bemerkte, somit erst Recht keine Widerstandshandlung ausgeführt habe.
Den Richtern fehlte es an der gezielten Widerstandshandlung des Klägers gegenüber dem Täter. Sei diese aufgrund der Schnelligkeit und des Geschickes der Wegnahme durch den Täter nicht gegeben, so dürfe nicht von einem Raub nach § 249 StGB, sondern vielmehr von einem sogenannten „Trickdiebstahl“ ausgegangen werden, welcher als normaler Diebstahl nach § 242 StGB gewertet werden muss.
Ein solcher Diebstahlsfall war jedoch im Versicherungsvertrag nicht enthalten. Der Kläger konnte sich auch nicht gemäß § 307 BGB darauf berufen, dass die Klauseln des Vertrages für ihn überraschend waren, weil dort explizit der Wortlaut des „Raubes“ benutzt wurde und auch einem juristischen Laien zugemutet werden kann, sich über die Versicherungsbedingungen selbständig zu informieren oder sich einer rechtliche Beratung zu unterziehen.
Kammergericht Berlin – Beschluss vom 06.12.2019 – 6 U 98/19
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Anwalt für Strafrecht
Strafrecht
Die Richter des Bundesgerichtshofes mussten sich im Januar 2019 seit längerer Zeit wieder mit der Befangenheit eines Richters gemäß § 24 Abs. 2 StPO beschäftigen und haben diesbezüglich weitere Konkretisierungen in ihrem Beschluss veröffentlicht.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im Jahr 2017 wurde vor dem Landgericht Berlin ein Strafverfahren gegen drei Angeklagte aufgrund bandenmäßigen Drogenhandels geführt. Am Ende des dritten Verhandlungstages kam es zwischen dem Vorsitzenden Richter der Strafkammer, einem weiteren Richter und den zwei Verteidigern eines Angeklagten zu einem geplanten Treffen. Dabei wurde diskutiert, ob der Mandant der Verteidiger nicht ein Geständnis ablegen möchte und bei der Aufklärung der Tatbeteiligung mit dem Gericht kooperiere, um so eine Strafmilderung zu gewährleisten. Aufgrund der nahen Verwandtschaft des erwähnten Angeklagten mit einem Mitangeklagten lehnten die Verteidiger eine Kooperation im Sinne eines Geständnisses über die Vorgänge zum Tatzeitpunkt ab. Der Vorsitzende Richter erwähnte nach Ende des Gespräches, dass über diese Verhandlungen Stillschweigen von höchster Priorität sei.
Nachdem die Verteidiger der restlichen zwei Mitangeklagten von dem Geheimtreffen erfuhren, stellten sie am nächsten Verhandlungstag unverzüglich Befangenheitsanträge gegen die beiden Richter.
Eine andere Kammer des Landgerichts Berlin prüfte die Anträge, sah jedoch keinerlei Besorgnis, was zur Zurückweisung der Befangenheit führte. Dies war auch dem Umstand geschuldet, dass laut Protokoll die übrigen Verfahrensteilnehmer am erwähnten Verhandlungstag, an dem auch die Befangenheitsanträge gestellt wurden, über die „Geheimabsprache“ informiert werden sollten, wozu es jedoch nicht kam. Zugleich folgte eine Verurteilung der Angeklagten wegen bandenmäßigen Drogenhandels.
Aufgrund dieses Umstandes legten zwei der drei Angeklagten gegen das Urteil Revision zum Bundesgerichtshof ein und begründeten Zweifel an der Entscheidung aufgrund der abgelehnten Befangenheitsanträge. In dieser Sache entschieden die Richter des BGH zu Gunsten der Angeklagten und hoben die Entscheidung der Strafkammer des Landgerichts Berlin auf. Die Richter hätten aufgrund der Geheimabsprache mit den Verteidigern nach § 24 Abs. 2 StPO abgelehnt werden müssen, was das Verfahren einer anderen Kammer des Landgerichts zugeleitet hätte, welche dann darüber hätte entscheiden müssen.
Der Gerichtshof betonte zudem, dass bei außerhalb der Hauptverhandlung geführten Gesprächen mit einzelnen Angeklagten unter Ausschluss der Mitangeklagten besondere Zurückhaltung geboten sei, um jeglichen Anschein von Parteilichkeit zu vermeiden.
Diese Parteilichkeit sei jedoch im oben genannten Fall durch das mögliche Geständnis zu Lasten der Mitangeklagten zu erkennen, welches hinter verschlossenen Türen und ohne Kenntnis derer verhandelt worden wäre. Durch die mangelnde Konfrontation der Richter mit ihrer Person sei diesen eine Art Ungerechtigkeit widerfahren, welche aus Sicht der Mitangeklagten berechtigte Zweifel an der Unvoreingenommenheit der Richter aufkommen lassen konnte.
Die Befangenheit hätte lediglich durch sofortige Aufklärung aller Verfahrensbeteiligter durch den Vorsitzenden vermieden werden können. Nur so wäre jeder Anschein der Heimlichkeit vermieden worden.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 10.01.2019 – 5 StR 648/18 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Der Amtsgericht Harburg hat in seinem Urteil aus dem Jahre 2009 den Beleidigungstatbestand des § 185 StGB weiter konkretisiert und demnach deutlich gemacht, dass das deutsche Strafrecht nicht vor bloßen – wenn auch groben Unhöflichkeiten – schütze.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte war als Besucher in die Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel gekommen, um einen Verwandten zu besuchen. Als dieser von den zuständigen Vollzugsbeamten vor Eintreffen in den Besucherraum auf etwaige Gegenstände durchsucht wurde, wurden jene fündig und verwiesen ihn daraufhin aufgrund eines Verstoßes gegen die Anstaltsordnung des Gefängnisgeländes. Als die Beamten den Angeklagten erneut aufforderten, das Gebäude zu verlassen, drehte dieser sich um und schrie: „Ihr kommt ja auch noch einmal aus der Anstalt und dann bekommt ihr auf die Fresse!“. Aufgrund Nachfrage der Beamten, was die Reaktion denn soll, erwiderte er erneut: „Ja, dann bekommt ihr richtig auf die Fresse“. Die Staatsanwaltschaft sah in diesem Verhalten eindeutig einen Verstoß gegen den Beleidigungstatbestand aus § 185 StGB.
Der verhandelnde Richter wies die Forderung der Verurteilung jedoch zurück, denn er sehe in der Aussage des Angeklagten noch keinen gewichtigen Angriff auf die Ehre eines anderen, was einen Freispruch zur Folge hat.
Dies begründete der Richter wie folgt:
Die Schwelle des § 185 StGB stelle eine tiefgreifende Ehrverletzung dar, welche in der Androhung der Körperverletzung jedoch noch nicht verwirklicht sei. Das Strafrecht habe nicht die Aufgabe, vor bloßer Ungehörigkeit, Distanzlosigkeit sowie Unhöflichkeit zu schützen. Dies würde dem „ultima ratio“-Aspekt nicht entsprechen, welchem das deutsche Strafrecht Sorge tragen soll.
Auch eine Androhung einer Straftat im Sinne des § 241 StGB sei zu verneinen, denn diese wäre indes nur strafbar, wenn es sich bei der angedrohten Tat um ein schwerwiegendes Verbrechen handeln würde, eine Körperverletzung nach § 223 StGB ist jedoch als Vergehen zu klassifizieren. Auch die Nutzung des § 185 StGB als Art „Auffangtatbestand“ des § 241 StGB verstoße gegen den Sinn und Zweck der Regelung und sei zu verneinen. Nicht jede Missachtung der körperlichen Integrität oder der Willensbetätigungsfreiheit könne in ein Beleidigungsdelikt umgedeutet werden.
Des Weiteren sei klarzustellen, dass der reine Ausdruck „Fresse“ als Synonym für Mund oder Gesicht eines anderen Menschen an sich noch keine Beleidigung, sondern lediglich einen „derben“ Ausdruck darstelle, welcher sozialethisch zwar als unhöflich zu kategorisieren ist, jedoch keiner Ehrverletzung gleichstehe. Würde man dies im obigen Kontext annehmen, so wäre der häufig genutzte Ausdruck „Halt die Fresse“ an sich eine Vollendung des Beleidigungstatbestandes und somit nach § 185 StGB strafbar, was jedoch in Anbetracht der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 GG wohl als kritisch zu bezeichnen wäre.
Die Vollzugsbeamten beriefen sich zudem in der Verhandlung darauf, dass das „duzen“ ihrer Person durch den Angeklagten ein ehrverletzendes Verhalten darstelle. Dieser Behauptung steuerte der Richter jedoch entgegen und argumentierte, dass aufgrund des starken Wandels der gesellschaftlichen Konvention ein reines „duzen“ eine alltägliche Anrede darstelle, welche für die meisten Menschen in der Gesellschaft völlig normal sei, und keine herabwürdigende Handlung.
Letztendlich wurde von den Beamten vorgetragen, dass diese sich auch durch das Nichtfolgen ihrer Anweisungen „beleidigt“ fühlten. Es sei jedoch von keinem Mitbürger „absolutes Gehorsam“ zu erwarten, womit auch bei Nichtbefolgung der Weisung kein persönlicher Angriff konstruiert werden könne. Dies würde ein sehr fragwürdiges und nicht mehr zeitgemäßes Spannungsverhältnis zwischen Beamten als Staatsorgan gegenüber den Bürgern schaffen, welches so nicht anzunehmen sei.
Aufgrund Nichterfüllung des objektiven Tatbestandes des § 185 StGB wurde der Angeklagte freigesprochen.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Oberlandesgericht Stuttgart hat im April 2017 durch einen Beschluss festgestellt, dass es straflos sei, jemand anderen dazu zu bringen, sich gegenüber einer Behörde als Fahrzeugführer auszugeben, obwohl ein anderer die Verkehrsordnungswidrigkeit begangen habe.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein Anwalt riet seinen zwei Mandanten, die Täter einer Verkehrsordnungswidrigkeit waren, eine ähnlich aussehende Person darum zu bitten, sich als Täter gegenüber der Bußgeldbehörde auszugeben. Damit sollte erreicht werden, dass die Bußgeldverfahren gegen die mutmaßlichen Täter geführt und nach gegebener Zeit gegenüber den Behörden die tatsächlichen Täter angegeben werden, was zur Einstellung des Verfahrens oder zum Freispruch der mutmaßlichen Täter führen soll. Ziel dieser Strategie war, dass aufgrund des Zwischenverfahrens genug Zeit gewonnen wird, damit dem Verfahren gegen die tatsächlichen Täter das Hindernis der Verjährung entgegensteht.
Nachdem die Staatsanwaltschaft Heilbronn dies erkannte, reichte diese eine Anklage gegen den Anwalt ein, da dieser aus Sicht der Beamten seine Mandanten zu einer falschen Verdächtigung anstiftete, welche in mittelbarer Täterschaft begangen wurde.
Das Landgericht Heilbronn ließ die Anklage jedoch nicht zu, denn aus Sicht der Strafkammer fehlte es an der zur Anstiftung erforderlichen Haupttat. Dagegen legte die Staatsanwaltschaft sofortige Beschwerde ein.
Das Verfahren wurde an das Oberlandesgericht Stuttgart geleitet, jedoch auch dort abgewiesen. Die Richter sahen keine Anstiftung nach § 26 StGB durch den Rat des Anwalts gegenüber seinen Mandanten, weil die erforderliche Haupttat durch die Mandanten, welche hier eine falsche Verdächtigung nach § 164 StGB darstellen sollte, nicht erfüllt sei. In der Selbstbezichtigung der mutmaßlichen Täter könne keine anstiftungsfähige Tat gesehen werden, da diese gegenüber der Bußgeldbehörde straflos sei.
Zudem haben sich die tatsächlichen Täter nicht wegen falscher Verdächtigung schuldig gemacht, denn diese hätten keinerlei Tatherrschaft über diese Selbstbezichtigung besessen, welche für die Erfüllung des § 164 StGB notwendig sei. Die mutmaßlichen Täter seien keine bloßen Werkzeuge gewesen, welche ein sogenanntes „Strafbarkeitsdefizit“ aufwiesen, sondern haben vielmehr voll verantwortlich gehandelt und die komplette Sachlage richtig erfasst und überblickt.
Somit konnte den tatsächlichen Tätern lediglich eine Anstiftungshandlung zugrunde gelegt werden, da Sie bei ihren Bekannten eine Art Tatentschluss zur Selbstbezichtigung hervorgerufen haben, welche jedoch straflos sei.
Somit sei die komplette Strafbarkeitskette aufgrund mangelnder Haupttat aufgelöst, was zu einem Freispruch des Rechtsanwalts als auch dessen Mandanten führte (OLG Stuttgart, Beschluss vom 07.04.2017 – 1 Ws 42/17 ).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht