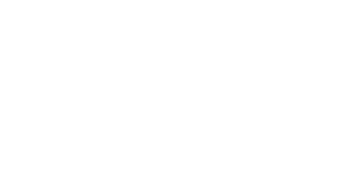Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Der BGH hat bereits im September 2014 für Recht befunden, dass ein Fehlgehen der ersten Ausführungshandlungen nicht zwangsläufig zu einem Fehlschlag des Versuchs – also dem Ausschluss des Rücktritts vom Versuch – führt.
Im vorliegenden Fall fasste der Angeklagte den Entschluss, sich während einer Flugstunde das Leben zu nehmen, wobei der Anschein eines Flugunfalls erweckt werden sollte. Er beabsichtigte hierbei, den Fluglehrer anhand eines Mineralbrockens bzw. eines Küchenmessers zu attackieren und zumindest außer Gefecht zu setzen und so das Flugzeug aufsehenerregend abstürzen zu lassen.
Nachdem mehrere Schläge mit dem Mineralbrocken sowie das Eindrücken der Augenhöhlen nicht zur Kampfunfähigkeit des Piloten geführt hatten, das Flugzeug sich aber bereits im Sinkflug befand, konnte der Pilot gerade noch eine Notlandung herbeiführen. Nach den Angriffen saß der Angeklagte während des Rettungsmanövers nur noch schweigend daneben.
Das LG Frankfurt (Oder) verurteilte den Angeklagten wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit dem versuchten Angriff auf den Luftverkehr mit Todesfolge. Die anschließend hiergegen gerichtete Revision des Angeklagten erachtete der BGH als zulässig und begründet, sodass das Urteil aufgehoben und die Sache zur erneuten Verhandlung an das LG Frankfurt (Oder) zurückverwiesen wurde.
Die Annahme des Landgerichts, der Angeklagte habe schon deshalb nicht vom Versuch zurücktreten können, weil der Versuch fehlgeschlagen sei, treffe insoweit nicht zu, so der BGH. Vielmehr ist für den Fehlschlag des Versuchs erforderlich, dass der Täter erkennt, dass die Tat mit den bereits eingesetzten oder naheliegenden Mitteln objektiv nicht mehr vollendet werden kann. Im vorliegenden Fall seien aber sowohl die Schläge mit dem Mineral als auch das Eindrücken der Augenhöhlen nach der Vorstellung des Angeklagten weiterhin möglich gewesen, sodass kein Fehlschlag gegeben sei (Beschluss des BGH September 2014).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Nach der Weigerung, ein angefordertes Gutachten über eine Blut- und Urinuntersuchung einzureichen, wurde dem Betroffenen seitens der Fahrerlaubnisbehörde die Fahrerlaubnis entzogen. Allein diesen Umstand sah das VG Minden in seinem Urteil vom März 2019 als unzureichend an. Begründet wurde dies damit, dass die Behörde nicht dazu berechtigt war, vom Antragssteller allein wegen des Besitzes von Marihuana ein Drogenscreening zu fordern.
Zwar kann der Drogenbesitz ein Indiz für einen Eigenverbrauch darstellen (siehe OVG Münster, NZV 02,427), jedoch müssen bei Cannabis zusätzlich konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die die Vermutung rechtfertigen, dass beim Betroffenen ständig fahreignungsrelevante körperlich-geistige Fahreignungsdefizite vorhanden sind oder dass der Konsum vom Cannabis und die Teilnahme am Straßenverkehr nicht voneinander getrennt werden können. Auch der Besitz einer geringen Menge Cannabis, die für den Eigengebrauch spricht, kann die Auferlegung einer Durchführung einer ärztlichen Untersuchung rechtfertigen. In diesem Fall müssen jedoch weitere Umstände gegeben sein, die einen regelmäßigen Konsum als nicht fernliegend erscheinen lassen. Liegen solche Anhaltspunkte hingegen nicht vor, kann die Fahrerlaubnis wegen des bloßen Besitzes von Cannabis nicht entzogen werden. Urteil vom VG Minden vom 09.03.2019.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat sich erneut bezüglich der Schwelle des „bedeutenden Fremdschadens“ aus § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB geäußert und hält an der eigenen „2.500€ – Rechtsprechung“ fest.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Beklagte befuhr im Februar 2019 mit seinem Ford Ranger die A73 nähe Nürnberg. Bei einem Spurwechselmanöver kollidierte dieser mit einem PKW, welcher soeben auf der linken Spur überholen wollte. Obwohl der Angeklagte bemerkt haben soll, dass es sich objektiv um einen nicht unbedeutsamen Fremdschaden handelte, verließ er die Unfallstelle vor Möglichkeit der Feststellung seiner Identität sowie der zusammenhängenden Schadensregulierung.
Das daraufhin angestrebte Gutachten stellte einen Schaden von 1984,72 € netto am überholenden PKW fest.
Nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB kann sich das Gericht nach der Regelvermutung der „Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen“ orientieren, wenn bei der Erfüllung des § 142 Abs. 1 StGB ein bedeutender Fremdschaden eingetreten ist. Dieser Wert gilt in der Rechtsprechung jedoch immer noch als umstritten und wird an den ordentlichen Gerichten unterschiedlich bewertet.
Ein Meilenstein, an welchen sich die meisten Landgerichte orientiert haben, war ein Schaden von 1.800 € netto. Dies wurde bis 2017 in ständiger Rechtsprechung praktiziert und weitestgehend auch so angewendet, außer ein Fall erforderte eine sorgfältige Einzelfallabwägung.
Mit dem Beschluss vom 05.12.2019 des Landgerichts Nürnberg-Fürth wurde dieser Wert auf 2.500 € netto angehoben. Die Richter begründeten dies wie folgt:
Der § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB sanktioniert neben dem bedeutsamen Fremdschaden auch die Verletzung von Leib und Leben, was eine Ungeeignetheit begründe. Dieser Aspekt müsse in Betrachtung zum Sachschaden dort eher restriktiv ausgelegt werden. Des Weiteren solle der Betrag erhöht werden, da die Verbraucherpreise für Wartung und Reparatur von Kraftfahrzeugen in den letzten Jahren angestiegen seien. So erhoffe sich die Kammer einen inflationären Ausgleich im Sinne der Billigkeit.
Im vorangegangenen Sachverhalt hat die Kammer des Landgerichts die Entscheidung des Amtsgerichtes, welches den Fahrzeugführer nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB als ungeeignet betrachtete, aufgehoben und das Urteil nach der 2.500 € – Rechtsprechung angepasst.
Die Fahrerlaubnisentziehung des Amtsgerichts war demnach rückgängig zu machen, da der Täter nicht in den Anwendungsbereich des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB fiel (LG Nürnberg-Fürth, Beschl. v. Dezember 2019).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Nachdem im November 2019 das Oberlandesgericht Frankfurt am Main zahlreiche Bußgeldbescheide für rechtswidrig erklärte, weil diese durch private Dienstleistungsunternehmen angezeigt wurden, zeigt das BayObLG bestimmte Voraussetzungen auf, damit ein hoheitliches Handeln auf Private übertragen werden kann und dies innerhalb der Rechtmäßigkeit verbleibt.
Dem Fall liegt ein Bußgeldbescheid zugrunde, welcher als Folge einer kommunalen Verkehrsüberwachung durch Leiharbeiter und weiterer technische Unterstützung durch private Dienstleister zustande kam. Das BayObLG hat sich bezüglich diesen Themas bereits im Jahre 2005 weitestgehend geäußert, greift viele Kernaussagen der damaligen Entscheidung auf und transferiert diese auf den neuesten Stand der Technik.
Nach den Leitsätzen der Entscheidung ist eine Beauftragung zur privaten Geschwindigkeitsüberwachung unter strengen Voraussetzungen rechtmäßig. Dazu müssen folgende Bedingungen erfüllt sein.
Erstens: Die Gemeinde darf von ihrer gesetzlichen Befugnis zur Verkehrsüberwachung Gebrauch machen und sich dabei privater Dienstleister bedienen, wenn sichergestellt werden kann, dass die Gemeinde weiterhin als „Herrin des Verfahrens“ angesehen werden kann. Aufgrund der Unbestimmtheit dieses Rechtsbegriffes sind folgende Kriterien mit Indizwirkung in die Einzelfallentscheidung miteinzubeziehen: Die Gemeinde müsse Vorgaben über Ort, Zeit, Dauer und Häufigkeit der Messungen, die Kontrolle des Messvorgangs, die Verantwortung für den ordnungsgemäßen Einsatz technischer Hilfsmittel und die Kontrolle über die Ermittlungsdaten festlegen. Auch die endgültige Entscheidung, ob und gegen wen ein Bußgeldverfahren einzuleiten ist, muss letztendlich in der Macht der Gemeinde stehen.
Zweitens: Das für die Messungen beauftragte Personal, welches nach dem Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) der Gemeinde „überlassen“ wird, muss hinreichend in die räumlichen und organisatorischen Strukturen der Gemeinde integriert sein sowie der zuständigen Organisationseinheit der Gemeinde hinreichend zugeordnet werden können und deren Leiter unterstellt sein. Unter diesen Voraussetzungen kann man davon ausgehen, dass auch der private Dienstleister als ein Teil der Staatsgewalt angesehen wird und somit als überlassene „Mess – bzw. Auswertungsperson“ der hoheitlichen Tätigkeit der Gemeinde zugerechnet wird.
Drittens: Die Gemeinde müsse hinreichend gewährleisten, dass zu jeder Zeit ein unbeschränkter Zugang zu den Messdaten der Leiharbeitnehmer ermöglicht wird, so dass eine Kontrolle entweder digital oder mit direktem Zugang zum Speichermedium geschehen kann.
Viertens: Auch sonst darf sich die Gemeinde technischer Hilfe von privaten Dienstleistern bedienen, solange diese nicht in Bereiche eingreifen, die ausschließlich hoheitliches Handeln erfordern und ein ordnungsgemäßer Einsatz der technischen Hilfsmittel garantiert werden kann. Dies ist gegeben, wenn die Messung selbst als auch die Auswertung bei der Gemeinde selbst verbleibt. Hier ist wieder auf den Begriff der „Herrin des Verfahrens“ abzustellen.
Beispielsweise wäre es möglich, Arbeitnehmer damit zu betrauen, bestimmte Daten der Messreihe zu optimieren (Aufhellung der Bilder, Qualitative Steigerung durch Bildbearbeitungen), solange die Gemeinde als letzte Kontrollinstanz die komplette Handlungsfreiheit über den Fortgang des Verfahrens behält.
Diese Entscheidung stellt eine Kontrast zum OLG-Urteil aus Frankfurt am Main dar und sollte diesbezüglich jedem Verkehrsrechtsexperten bekannt sein. Falls Sie in einen solchen Fall verwickelt sind, ist es unabdinglich, einen Spezialisten mit dieser Sache zu betrauen, denn solch komplexe Fehlerquellen können lediglich im Rahmen einer intensiven Akteneinsicht – und Bearbeitung entlarvt und zugunsten ihrer Verteidigung verwendet werden.
BayObLG, Beschl. v. 29.10.2019 – 202 ObOWi 1600/19
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Obwohl das „Corona-Virus“ die Bundesrepublik in der heutigen Zeit fest im Griff hat und für andere Themen kaum noch Freiraum besteht, tritt am Dienstag dieser Woche, also am 28.04.2020, die neu beschlossene StVO-Novelle in Kraft, welche tief greifende Änderungen des Bußgeldkatalogs mit sich bringt.
Einige dieser Änderungen sollten sich Autofahrer ab kommender Woche bewusst machen, denn selbst kleinere Unachtsamkeiten im Straßenverkehr können nun verheerende Folgen hinsichtlich der Fahrerlaubnis sowie extreme Bußgeldsummen nach sich ziehen.
Hier einige Beispiele, wie sich die Novelle auf den aktuellen Sanktionskatalog auswirkt.
Tempolimit: Der alte Bußgeldkatalog schrieb demnach vor, dass bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung innerorts um 31 km/h ein Fahrverbot von einem Monat verhängt werden soll. Nach der Einarbeitung der StVO-Novelle soll das Fahrverbot bereits ab Überschreitungen von 21 km/h ausgesprochen werden. Demnach wurde der drohende Eintrag im Verkehrszentralregister von einem auf zwei Punkte erhöht.
Außerorts gilt eine ähnliche Verschärfung. Dort soll bereits bei einer Überschreitung ab 26 km/h ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte drohen.
Rettungsgasse: Auch hinsichtlich der Rettungsgassenbildung haben sich einige Änderungen eingeschlichen. Wer ab kommender Woche keine Rettungsgasse bildet, dem drohen 200 € Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot, auch ohne Verwirklichung einer konkreten Gefahr oder Behinderung eines Rettungswagens, wie es zuvor der Fall war.
Wer eine solche Rettungsgasse nun als „Abkürzung“ benutzt, um dem langwierigem Verkehr zu entkommen, muss mit 240 €, zwei Punkten sowie einem Monat Fahrverbot rechnen.
Halten: Eine weitere einschneidende Änderung wurde hinsichtlich des Haltens in zweiter Reihe eingeführt, was weitreichend in größeren Städten mit Parkplatzmangel beobachtet wird. Das kurze Halten des Wagens in zweiter Reihe kostet künftig 55 € Bußgeld, sobald man andere Verkehrsteilnehmer durch sein Fahrzeug behindert, wird dies auf 70 € in Verbindung mit einem Punkteeintrag erhöht. Die gleichen Vorschriften gelten demnach auch für das Parken auf Geh – und Radwegen sowie das Halten auf sogenannten „Schutzstreifen“. Letzteres solle vorwiegend Kollisionen zwischen Radfahrern und nicht ordnungsgemäß-geparkten Kraftfahrzeugen vorbeugen, was sich nach der Statistik des Bundes in den letzten Jahren zugetragen hat.
Radfahrer: Um daran anzuknüpfen, hat sich der Bund für die Radfahrer der Republik einige Änderungen einfallen lassen. Einerseits wurden neue Schilder eingeführt, welche eine Grünpfeilregelung nun auch für Radfahrwege ermöglichen, andererseits werden mit der Änderung sogar komplette „Fahrradzonen“ ermöglicht, welche als Alternative zu den „Tempo-30-Zonen“ lediglich Fahrradfahrern zugänglich sind. Des Weiteren wurde der Mindestseitenabstand beim Überholen von Radfahrern, Fußgängern und neuartigen E-Scootern nun gesetzlich festgelegt. Zuvor regelte die StVO lediglich einen „ausreichenden Seitenabstand“, mit der neuen Novelle sind außerorts 2 Meter und innerorts 1,5 Meter Seitenabstand einzuhalten.
Blitzer-App: Was in den letzten Jahren viele dubiose Gerichtsentscheidungen hervorgebracht hat, wollte der Gesetzgeber nun endgültig klären und hat auch folgende Vorschrift in die neue StVO aufgenommen. Seit Neuestem sind Apps, welche gerne auf Smartphones oder Navigationsgeräten installiert wurden, um auf stationäre sowie mobile Radarwarngeräte aufmerksam gemacht zu werden, verboten. Wer bei Bedienung einer solchen App erwischt wird, dem drohen 75 € Bußgeld sowie ein Punkteeintrag in Flensburg.
Letztendlich bleibt nun abzuwarten, wie die Gerichte die konkreten neuen Vorschriften in ihre Rechtsprechung einfließen lassen. Sollten Sie dennoch bereits den verschärften Regelungen zum Opfer gefallen sein, so ist es ratsam, schnellstmöglich einen Verkehrsrechtsexperten zurate zu ziehen, um eine effektive Verteidigung zu gewährleisten und lebenseinschneidenden Sanktionen wie beispielsweise einem Fahrverbot, oder gar einem rigorosen Bußgeld entgegenzuwirken.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Die Richter des Bundesgerichtshofes haben in ihrer verkehrsrechtlichen Entscheidung vom 27.03.2019 die Begründungspflicht des § 69 Abs. 1 StGB bei der Maßregelung des Fahrerlaubnisentzuges weiter konkretisiert.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Beklagte wurde vom erstinstanzlich-zuständigem Landgericht Konstanz aufgrund eines Verstoßes gegen § 21 Abs. 1 Nr.1 Straßenverkehrsgesetz verurteilt, da dieser bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte.
Obwohl auch der § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG ein solches Straßenverkehrsdelikt ist, bei dem eine Entziehung der Fahrerlaubnis durch das Gericht nach § 69 Abs. 1 Satz 1 StGB üblich ist, müsse dennoch das Tatbestandsmerkmal der „Ungeeignetheit zur Führung von Kraftfahrzeugen“ bei dem Beklagten erfüllt sein.
§ 69 Abs. 2 StGB stellt eine Regelvermutung für die „Ungeeignetheit“ auf, wenn bestimmte Strafvorschriften der sogenannten „gemeingefährlichen Straftaten“ (§§ 315ff. StGB) erfüllt wurden. In diesem Katalog wird beispielsweise die „Trunkenheit im Verkehr“ nach § 316 StGB aufgelistet, Straftatbestände aus dem StVG sind dort jedoch nicht explizit gelistet. Demnach fehlt auch die Annahme einer Regelvermutung der Ungeeignetheit für den Verstoß des § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG.
Das zuständige Landgericht hat somit eine ausführliche Begründung für die Ungeeignetheit des Beklagten zu unterbreiten. Die Tatrichter des LG begründeten die Ungeeignetheit jedoch lediglich mit der Führung ohne Fahrerlaubnis, es fand keine weitere tatrichterliche Würdigung des Einzelfalles statt.
Dagegen wandte sich der Beklagte mit einer Revision zum Bundesgerichtshof. Dieser urteilte, dass die Begründung des Landgerichtes nicht ausreicht, sondern eine Gesamtwürdigung jeglicher Umstände auch in Verbindung zur Täterpersönlichkeit durch die Richter erfolgen muss, wenn das Delikt nicht im Regelvermutungskatalog des § 69 Abs. 2 StGB aufgelistet ist.
Die Entscheidung wurde nach Konrektisierung der Begründetheitsobliegenheit zurück an das Landgericht Konstanz verwiesen.
BGH, Beschl. v. 27.03.2019 4 StR 360/18
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das OLG Zweibrücken musste sich in einer Entscheidung aus dem Februar 2019 mit der Glaubwürdigkeit und Fehleranfälligkeit von Atemalkoholmessungen – sowie deren Geräten auseinandersetzen.
Nach den Feststellungen des erstinstanzlichen Amtsgerichtes befuhr der Betroffene mit seinem PKW eine Straße in Edesheim, in welcher eine polizeiliche Kontrolle durchgeführt wurde. Als Routineuntersuchung der Beamten wurde ein Atemalkoholtest mit dem Gerät ALCOTEST 9510 der Firma Dräger durchgeführt. Beide kurz hintereinander durchgeführte Analysen ergaben eine Atemalkoholkonzentration von 0,250 mg/l.
Das Amtsgericht ging von dem Umstand aus, dass es sich um ein korrektes, nicht durch äußere Einflüsse zu Ungunsten des Betroffenen veränderten Messergebnis handelte.
Der Betroffene ließ sich jedoch demnach ein, dass er behaupte, dass die Atemalkoholkonzentration durch das Gerät fehlerhaft festgestellt wurde, da es zu einem Hypoventilationsfehler kam. Davon ist die Rede, wenn die Atmung in das Gerät als zu oberflächlich oder zu langsam geschehe und demnach die gemessenen Stoffe durch die Sensoren nicht ausreichend ausgewertet werden können.
Dies wurde vom Tatrichter jedoch nicht weiterhin gewürdigt, da es sich im rechtlichen Ausgangspunkt um ein sogenanntes „standartisiertes Messverfahren“ handelt, bei dem etwaige Messfehler nicht zu rügen sind, solange keine konkreten Anhaltspunkte für solche Fehler behauptet wurden oder in irgendeiner Art und Weise ersichtlich sind (dazu: Brandenburgisches OLG, Beschluss vom 31.01.2007 – 2 Ss (OWi) 228 B/06).
Des Weiteren wurde die Behauptung einer Fehlmessung von den Beamten dementiert, da dass Gerät in solchen Fällen einer Hypoventilation einen Fehler ausgeben müsse und die Messung unterbrochen werde. Durch zweifache Durchführung der Messung mit vergleichbaren Werten sei eine solche Behauptung wohl haltlos. Demnach urteilte das Amtsgericht, dass es sich bei der Einlassung des Angeklagten lediglich um eine Schutzbehauptung handele.
Dagegen wandte sich der Betroffene mit einer Rechtsbeschwerde, welche die Entscheidung zum OLG Zweibrücken führte. Dort wurde festgestellt, dass die Hypoventilationseinlassung zwar als Schutzbehauptung zu kategorisieren sei, das Amtsgericht dies jedoch nicht tragfähig begründete. Zwar habe das Amtsgericht richtig erkannt, dass die Maßstäbe des standartisierten Messverfahrens angewendet werden können, jedoch hat es die Fehlerquellenwahrscheinlichkeit des Gerätes nicht hinreichend begründet.
Das OLG kam zu dem Entschluss, dass eine fehlerhafte Messung unter besonderen Umständen in Betracht komme. Diese könne auch hier durch eine zweifach hintereinander angewandte Atemtechnik entstehen, da die Fehlermeldung einer Hypoventilation erst beim zweiten Versuch in Differenz zum ersten Versuch ordnungsgemäß angezeigt werden kann. Wenn es bei beiden Versuchen jedoch bereits zu einem Fehler gekommen ist und die technische Anzeige versagt hat, so kann dies im Nachhinein nicht mehr festgestellt werden.
Dieser Punkt wurde vom Amtsgericht nicht ausreichend in Erwägung gezogen. Das OLG hat die Entscheidung demnach wieder zurück an das Amtsgericht verwiesen, mit der Bemerkung, dass die Glaubhaftigkeit einer solchen Einlassung unter Berücksichtgung der übrigen Gesamtumstände kritisch zu hinterfragen sei und dies allein der tatrichterlichen Würdigung obliege.
OLG Zweibrücken, Beschl. v. 07.02.2019 – 1 OWi 2 Ss Bs 83/18
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Urteil, 729 Ds-253 Js 1513/19-256/19, welches am 19.11.2019 am Amtsgericht Dortmund von einem Strafrichter gefällt wurde, beschäftigt sich mit den Konkurrenzen zwischen Strafvorschriften und Ordnungswidrigkeiten und der davon abhängigen Strafschärfung im Sinne des Strafrahmens.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte wurde bei einer abendlichen Rundfahrt von einer Polizeistreife routinemäßig kontrolliert. Dabei konnte dieser keine Fahrerlaubnis vorweisen. Des Weiteren ergaben sich durch eine Blutentnahme Wirkstoffe von Cannabis und Kokain, welche weit über den Grenzwerten angesiedelt waren. Demnach kam ein Verstoß des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach § 21 Abs. 1 Nr.1 StVG (Straftat) sowie ein Verstoß gegen § 24a Abs. 2 StVG (Ordnungswidrigkeit) aufgrund der berauschenden Mittel in Betracht.
Da es sich um eine Straftat und eine Ordnungswidrigkeit handelt, welche in Tateinheit erfüllt wurden, müsse § 21 OWiG angewandt werden, wonach eine Ordnungswidrigkeit in Konkurrenz zu einem Straftatbestand hinter diesem zurücktritt. Somit wäre allein § 21 Abs. 1 Nr. 1 StVG die Strafnorm.
Dem Beklagten wurde auferlegt, 120 Tagessätze á 10 € zu entrichten. Des Weiteren ist es ihm von einer Dauer von einem Monat verboten, jegliche Kraftfahrzeuge zu führen. Zusätzlich wurde die Verwaltungsbehörde angewiesen, vor einem Zeitablauf von einem Jahr keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen, welche der Beklagte zum Zeitpunkt des Urteiles nicht besaß.
Obwohl das Fahrverbot aufgrund der Straftat und dem damit verbundenen § 69 Abs. 1 StGB ausgesprochen wurde, hat die Ordnungswidrigkeit bezüglich des Strafmaßes eine strafschärfende Wirkung entfaltet, die der Tatrichter nach §§ 24a Abs. 2 StVG i.V.m. 25 Abs. 1 Satz 2. StVG begründete. Dadurch, dass der Beklagte keine Fahrerlaubnis besaß, war eine Entscheidung bezüglich einer Schonfrist nach § 25 Abs. 2a StVG hinfällig.
Die 12-monatige Sperrfrist zur Neuerteilung fußt jedoch allein auf dem Straftatbestand des §21 Abs. 1 Nr. 1 StVG i.V.m. § 69 Abs. 1 StGB.
Amtsgericht Dortmund: Urteil vom 19.11.2019 – 729 Ds-253 Js 1513/19-256/19
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
In dem vom Niedersächsischen OVG zu verhandelnden Fall wurde dem Antragsteller (AS) vom Antragsgegner, der Behörde, die Fahrerlaubnis entzogen. Gestützt wurde dies auf die Annahme der Nichteignung zum Führen von Kfz nach § 11 Abs. 8 FeV, nachdem das ärztliche Gutachten einer amtlich anerkannten Begutachtungsstelle für Fahreignung nicht vorgelegt worden war.
Der Grund hierfür war eine Verurteilung des AS wegen unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln, von der die Behörde Kenntnis erlangte hatte. Als Rechtsgrundlagen für die Anordnung wurden die § 46 Abs. 3 FeV i.V.m. § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 sowie S. 3 und § 11 Abs. 2 S. 3 FeV herangezogen. Zudem begründete die Behörde die Anordnung fehlerhaft damit, dass der AS Ecstasy erworben (statt verkauft) hätte.
Der AS reichte Klage beim VG Oldenburg ein, welches jedoch die offensichtliche Rechtmäßigkeit der Gutachtenanordnung mangels Ermessensfehler und die Zulässigkeit der Annahme der Nichteignung feststellte. Die hiergegen gerichtete Beschwerde des AS vor dem OVG war zumindest teilweise erfolgreich.
Die Ermächtigungsgrundlage des § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 FeV räumt der Behörde kein Ermessen ein, wohingegen dies bei § 14 Abs. 1 S. 2 der Fall ist. Das OVG wies darauf hin, dass die Gutachtenanordnung ausdrücklich nur auf § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 FeV gestützt worden sei. § 14 Abs. 1 S. 2 FeV habe keinerlei Erwähnung gefunden. Die Behörde habe daher das ihr in § 14 Abs. 1 S. 2 FeV eingeräumte Entschließungsermessen nicht ausgeübt, was jedoch vom VG ohne überzeugende Begründung angenommen worden sei. Ohne Ermessensausübung könne die Überprüfung einer fehlerfreien Ausübung aber nicht stattfinden. Darüber hinaus sei zu beachten, dass die Ausübung eines Auswahlermessens gem. § 14 Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 11 Abs. 2 S.3 FeV die eines Entschließungsermessen nicht ersetzen könne.
Die Tatsache, dass die Behörde u.a. § 14 Abs. 1 S. 3 FeV zitierte, darf zudem nicht zu der falschen Schlussfolgerung führen, die Behörde habe im Ergebnis doch ein Ermessen ausgeübt. Denn bei genauerer Betrachtung habe die Behörde zum einen ja § 14 Abs. 1 S. 1 FeV angeführt, was zeige, dass sie von der Verpflichtung zur Anordnung ausging und es daher sinnwidrig wäre, zeitgleich einen Willen zur Ermessensausübung anzunehmen. Zum anderen beinhalte die Rechtsfolge des § 14 Abs. 1 S. 3 FeV die Anordnung der Beibringung eines medizinisch-psychologisches und nicht nur eines ärztlichen Gutachtens.
Das OVG hielt schließlich fest, dass ein Fahrerlaubnisinhaber einer Gutachtenanordnung grundsätzlich nicht Folge zu leisten habe und somit auch nicht auf die mangelnde Fahreignung geschlossen werde könne, wenn im Bescheid allein nicht einschlägige Ermächtigungsgrundlagen genannt würden. Der von der Behörde zitierte § 14 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 war hier nicht einschlägig, weil er die Einnahme von Betäubungsmitteln voraussetzt und es insoweit an Tatsachen, die die Annahme gerechtfertigt hätten, dass der AS selbst Ecstasy einnahm, fehlte. Für eine solche Annahme reiche auch eine Zusammenschau des Drogenbesitzes zu Verkaufszwecken und der gelegentliche Cannabiskonsum des AS nicht aus (Niedersächsisches OVG, Beschluss vom 26.09.2019, 12 ME 141/19).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht

Seitdem Vorreiter Bayern ab dem 20.03.2019 eine offiziell „gelockerte“ Ausgangssperre gegenüber seinen Bürgern verhängt hat, herrscht Unsicherheit in der Gesellschaft, was denn noch erlaubt ist und was gegen das Infektionsschutzgesetz verstößt und eventuell auch Bußgeldbescheide oder sogar Strafbefehle nach sich ziehen kann.
Aufgrund des föderalistischen Systems der sechzehn Bundesländer in der Bundesrepublik Deutschland müsse man sich in jedem Bundesland an die eigenen, eventuell unterschiedlichen Regelungen der Ausgangsbeschränkungen halten, was für einen „Ottonormalverbraucher“ schier unmöglich erscheint.
Was im Herbst 2019 noch als unmöglich angesehen wurde, ist heute bittere Realität. Jedoch ist fraglich, ob der Staat solch starke Eingriffe in die Grundrechte der Bürger überhaupt auf das IfSchG stützen könne? Allein die Anordnung häuslicher Quarantäne greife stark in Art.2 Abs. 2 Satz 2 GG ein, die Vermeidung sozialer Kontakte schneide in das Allgemeine Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG ein. An Versammlungsfreiheit aus Art. 8 Abs. 1 GG ist zurzeit nicht zu denken, Gastronome und Hotelbesitzer haben keine Möglichkeit mehr, ihre Arbeit wirksam auszuüben, was einen Eingriff in Art. 12 Abs. 1 GG begründet.
Die Bürger fragen sich, ob ein solch immenser Eingriff in diverse Grundrechte vom Staat überhaupt angeordnet werden darf? Dies wird aktuell scharf diskutiert. Die Verordnungen der Bundesländer zur Abwehr des Coronavirus müssen demnach einer Ermächtigungsgrundlage entspringen sowie auch rechtmäßig sowie verhältnismäßig sein.
Die Ermächtigungsgrundlage der Rechtsverordnungen der einzelnen Bundesländer sei wohl § 28 Abs. 1 des Infektionsschutzgesetzes, wonach die Behörde „notwendige Maßnahmen“ ergreifen darf, soweit und solange diese zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist.
Hier ist demnach schon strittig, ob eine einzelne Ermächtigungsgrundlage wie § 28 Abs. 1 IfSG in der Lage ist, eine komplette Nation zum Stillstand zu bringen. Viele Stimmen führen demnach die Unbestimmtheit der Grundlage in Abwägung zu den schwerwiegenden Eingriffen in Grundrechte der Bürger ins Feld. Als Grundsatz ist bekannt, dass eine Norm je ausführlicher begründet diese erscheint auch intensivere Eingriffe in Grundrechte zulasse, da durch diese Feinheiten die Abstraktheit der Gesetzesnorm zerschlagen werde und eine höhere Anzahl an „Einzelfällen“ geregelt werden könne. Das im juristischen Fachjargon unter „Bestimmtheitsgebot“ bekannte Prinzip ist aus den Leitsätzen der Rechtsstaatlichkeit der BRD nach Art. 20 Abs. 3 GG abzuleiten. Jedoch sind alle Argumentationen, den Bestimmtheitsgrundsatz zu schützen, an den Verwaltungsgerichten gescheitert (Bsp.: VG Göttingen, Beschl. v. 20.03.2020 – 4 B 56/20; VG Minden, Beschl. v. 02.04.2020 – 7 L 272/20; VG Neustadt a. d. Weinstraße, Beschl. v. 02.04.2020 – 4 L 333/20). In diesen Fällen wird seitens der Verwaltungrichter argumentiert, dass eine solche Ausnahmesituation auch etwaige Erfordernisse des Bestimmtheitsgebotes zurücktreten lassen müsse, um das Leib und Leben anderer Menschen ausreichend zu schützen.
Des Weiteren ist fraglich, ob die Maßnahmen in ihrer Gesamtabwägung als verhältnismäßig einzustufen sind. Diesem Grundsatz müssen alle Corona-Verordnungen unterliegen. Die Verhältnismäßigkeit setzt sich aus 4 Stufen zusammen:
Die Regelung muss einen legitimen Zweck verfolgen, welcher bei der Corona-Pandemie wahlweise der Gesundheitsschutz der Bevölkerung als auch die Verringerung des Infektionsrisikos darstellt.
Zusätzlich müssen die Regelungen geeignet sein, den legitimen Zweck zu erreichen. Covid-19 besteht jedoch erst seit Dezember 2019 und ist demnach weitestgehend unerforscht, demnach kann noch nicht mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit festgestellt werden, dass die Maßnahmen, welche zurzeit von der Regierung unternommen werden, auch tatsächlich im juristischen Sinne dazu geeignet sind, den legitimen Zweck zu pflegen. Aufgrund diesen Umstandes sind die Regierung sowie auch die Landesregierung in der Pflicht, ständige Überprüfungen über den Fortgang des Virus durchzuführen. Nach heutigem Stand der Wissenschaft kann man jedoch davon ausgehen, dass die Maßnahmen dazu geeignet sind, das Ausbreitungsrisiko der Pandemie effektiv einzudämmen.
Eine weitere Hürde der Verhältnismäßigkeit stellt das Merkmal der „Erforderlichkeit“ dar. Diese ist nur zu bejahen, wenn sie die mildeste Maßnahme unter allen gleich geeigneten Mitteln darstellt. In dieser Hinsicht ist ähnlich wie in der Geeignetheit vom aktuellen Wissenschaftsstand auszugehen. Solange dieser noch keine neuen, bahnbrechenden Erkenntnisse geliefert hat, müsse auf den Umstand eingegangen werden, dass der legitime Zweck hinreichend erfüllt werden kann. Man hat zum jetzigen Zeitpunkt, welcher wohl den Höhepunkt der Pandemie darstellt, wohl kein milderes Mittel als Ausgangsbeschränkungen zur Verfügung, um weitere Tröpfcheninfektionen zu vermeiden. Demnach sei auch die Erforderlichkeit der Ausgangsbeschränkungsverordungen erfüllt.
Letztendlich wird die Verhältnismäßigkeit vom Merkmal der Angemessenheit getragen. An dieser Stelle erfolgt eine Abwägungsentscheidung der betroffenen Güter. Hier müsse demnach Gesundheit in Form von Leib und Leben nach Art. 2 Abs. 2 GG mit den restlichen, betroffenen Grundrechten abgewogen werden. Diese Abwägung muss letztendlich vom Gericht geprüft werden, in letzter Instanz ist in diesem Fall das Bundesverfassungsgericht zuständig. Aufgrund aktueller Weiterentwicklung der Situation und auch etwaiger Hindernisse im Justizfortgang ist eine endgültige Entscheidung dieser Rechtsfrage wohl noch in sehr weiter Ferne.
Ein Anhaltspunkt liefert jedoch der Bayerische Verfassungsgerichtshof am 26.03.2020. Dort hatte ein bayerischer Bürger gegen die erlassene Ausgangsbeschränkungen Verfassungsbeschwerde eingelegt, weil er sich zu stark in seinen Grundrechten eingeschränkt fühlte. In einer einstweiligen Anordnung des BayVerfGH hat dessen Präsident jedoch in freier richterlicher Abwägung entscheiden, dass es zu dem Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht absehbar ist, wie effektiv die Maßnahmen gegen die Bekämpfung des Viruses sind. Die mit der Ausgangsbeschränkung verbundenen Grundrechtseingriffe seien zwar extrem tiefgreifend, jedoch ist nach aktuellem Anlass der Schutz der Allgemeinbevölkerung über die Individualinteressen eines Einzelnen zu stellen. Die Beschwerde wurde demnach im Eilverfahren abgelehnt.
Die Vielzahl an Gerichtsentscheidungen spiegelt im aktuellen Zeitpunkt die Unsicherheit und Unwissenheit der Justiz wieder. Die Corona-Verordnungen sind mit unbestimmten Rechtsbegriffen nahezu übersäht, was willkürliche Entscheidungen der kontrollierenden Ordnungs – und Polizeibehörden provoziert.
Falls Sie den schwammigen Corona-Regelungen „zum Opfer gefallen“ sind, sollten sie schnellstmöglichst einen Anwalt konsultieren, welcher ihnen durch detaillierte Akteneinsicht die Chancen einer Verteidigung offenlegen kann. Die Rechtsprechung hat sich zu Zeiten der Corona-Krise noch nicht eingeschwungen und keinen gleichen Nenner gefunden. Demnach ist eine Verteidigung gegen Ihren Bußgeldbescheid, oder gar Strafbefehl durch einen Anwalt unabdingbar und auch sinnvoll.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Bild: bluedesign – stock.adobe.com / adobestock_329560865.jpeg
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht