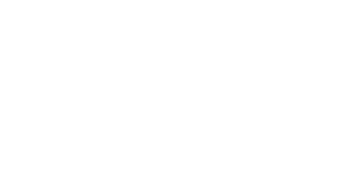Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
In dem vom OLG Bamberg zu verhandelnden Fall fuhr der Betroffene alkoholisiert im Straßenverkehr. Als die Polizeibeamten die Wohnung von ihm aufsuchten und ihn antrafen, fragten sie ihn, wo er herkomme und sein Auto sei. Sie erfuhren, dass er mit dem Pkw zum Getränkemarkt gefahren war und das Auto dann in der Tiefgarage abgestellt hatte.
Daraufhin wurden ein Atemalkoholvortest sowie eine AAK-Messung durchgeführt, nachdem der Betroffene als Beschuldigter belehrt worden war. Dann fand eine förmliche Anhörung statt, bei der der Betroffene die Alkoholfahrt zugab.
Der Betroffene wurde vom AG zu einer hohen Geldbuße mit einmonatigem Fahrverbot verurteilt. Die Überzeugung des Richters von der Täterschaft fußte nur auf den Aussagen der Polizisten über die Angaben des Betroffenen bei seiner ersten Befragung beim Antreffen an der Wohnung. Die Angaben im Rahmen der förmlichen Anhörung wurden nicht herangezogen. Die hiergegen gerichtete Rechtsbeschwerde vor dem OLG, die die unterbliebene Schweigerechtbelehrung durch die Polizisten vor der Befragung rügte, war erfolgreich. Sie führte zur Aufhebung des AG-Urteils sowie Zurückverweisung an das AG zur erneuten Verhandlung und Entscheidung.
Dem OLG zufolge wurde bei der ersten Befragung des Betroffenen beim Antreffen an der Wohnung in dessen Aussageverweigerungsrecht nach §§ 55, 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. §§ 136 Abs. 1 S. 2, 163a Abs. 4 S. 2 StPO eingegriffen, weil sich der Befragte bereits in diesem Zeitpunkt in der Rolle eines Betroffenen befand und es sich nicht mehr um eine rein informatorische Befragung handelte. Die Betroffeneneigenschaft setze voraus, dass sich der Verdacht bereits so verdichtet habe, dass die vernommene Person ernstlich als Täter oder Beteiligter der untersuchten Tat in Betracht komme. Vorliegend wurde pflichtwidrig verkannt, dass sich der Tatverdacht des Führens eines Kfz nach Alkoholgenuss schon i.o.g. Zeitpunkt so stark verdichtet hatte, dass eine Belehrungspflicht bzgl. der Aussageverweigerung bestand. Der Verdacht ließ sich zum einen auf die Tatsache stützen, dass die Ehefrau des Betroffenen dessen Trunkenheitsfahrt gemeldet hatte und dieser unmittelbar nach der Fahrt angetroffen wurde, was darauf hinwies, dass er unterwegs gewesen war. Zum anderen war ein deutlicher Alkoholgeruch wahrnehmbar.
Nach Ansicht des OLG zog der Verstoß gegen die Selbstbelastungsfreiheit auch ein Beweisverwertungsverbot hinsichtlich der Angaben des Betroffenen gegenüber den Beamten nach sich. Das Gericht betonte, dass ein Beweisverwertungsverbot im Strafverfahren gerechtfertigt erscheine, wenn gegen eine Verfahrensvorschrift verstoßen werde, deren Zweck in der Sicherung der Grundlagen der verfahrensrechtlichen Stellung des Beschuldigten liege. Die in § 136 Abs. 1 Satz 2, 163a Abs. 4 S. 2 StPO verankerte Belehrungspflicht bzgl. des Aussageverweigerungsrechts des Beschuldigten verfolgt eben diesen Zweck, den Schutz der Selbstbelastungsfreiheit, um ein rechtsstaatliches und faires Strafverfahren zu gewährleisten.
Im Übrigen gelte das Verwertungsverbot für Äußerungen des Betroffenen ohne vorherige Schweigerechtbelehrung nicht nur im Straf- , sondern auch im OWi-Verfahren, auch wenn der BGH dazu bisher keine Stellung bezogen habe. Dies ergebe sich daraus, dass der Zweck der Belehrung in beiden Verfahren derselbe sei und der Betroffene, zumindest bei einer mündlichen Anhörung, wie der Beschuldigte i.d.R. unvorbereitet sei und sich ohne Ratgeber in einer für ihn ungewohnten Lage befände (OLG Bamberg, Beschluss 27.08.2018, 2 Ss OWi 973/18).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Der Bundesgerichtshof (BGH) hat im April 2019 per Beschluss ein Urteil des Landgerichts Augsburg aufgehoben, in dem die Angeklagte wegen besonders schweren Raubes gem. § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt vier Jahren und acht Monaten verurteilt worden war.
Nach den Feststellungen des Landgerichts sei die Angeklagte im Mai 2018 aus ihrer Haft entlassen worden und habe sich entschlossen unter Anwendung eines ursprünglich zu Selbstverteidigungszwecken angeschafften Pfeffersprays gewaltsam ein Mobiltelefon zu entwenden.
Sie sei hierzu am 15. Mai 2018 in der Innenstadt in Augsburg gezielt auf die Geschädigte zugegangen als sie diese mit einem Mobiltelefon der Marke „Samsung Galaxy S 7“ in der Hand erblickt habe und sprühte dieser sodann Pfefferspray in das Gesicht, um das Mobiltelefon an sich zu nehmen und es in ihre Hosentasche zu stecken. Nach nur wenigen Schritten wurde die Angeklagte schließlich durch Passanten und Polizeibeamte festgenommen.
Bei der Beweiswürdigung stellte das LG Augsburg hierzu allerdings im Urteil fest, dass es der Angeklagten einhergehend mit ihrer geständigen Einlassung sowie weiteren Zeugenaussagen zum Fluchtverhalten explizit darum gegangen sei, durch die Tat von der Polizei festgenommen und erneut einer Justizvollzugsanstalt zugeführt zu werden. Im Ergebnis bejahte das LG Augsburg dennoch die sog. rechtswidrige Zueignungsabsicht der Täterin im Rahmen des Raubtatbestandes nach § 249 Abs. 1 StGB.
Diese Bewertung sei allerdings rechtsfehlerhaft gewesen, sodass das Urteil aufzuheben war, so der BGH.
Der Raubtatbestand setze nach § 249 I StGB nämlich voraus, dass der Täter im Zeitpunkt der Wegnahme der Sache mit Zueignungsabsicht handele.
Nach der ständigen Rechtsprechung liegt eine solche Zueignungsabsicht dann vor, wenn der Täter sich unter Anmaßung einer eigentümerähnlichen Stellung die entwendete Sache oder aber auch ihren verkörperten Sachwert zumindest vorübergehend der eigenen Vermögenssphäre einverleiben (sog. Aneignung) und den Berechtigten dauerhaft aus seiner Gewahrsamsposition verdrängen (sog. Enteignung) möchte.
Geht die Täterin – so wie hier – allerdings davon aus, dass das Mobiltelefon infolge ihrer polizeilichen Ergreifung in der Folgezeit wieder an die Geschädigte zurückgelangen würde, fehlt es aber bereits an einer Aneignungsabsicht, sodass die Zueignungsabsicht generell ausgeschlossen wird. Unbeachtlich sei es laut BGH hierbei auch, wenn die Aneigung nur als mögliche Folge des Tatverhaltens durch die Täterin in Kauf genommen werde. Es bedürfe dann zur Annahme einer Zueignungsabsicht vielmehr der subjektiven Vorstellung der Täterin, dass die erstrebte Festnahme lediglich ein für sie nachrangiges sogenanntes Fernziel darstelle.
Einmal mehr zeigt die Entscheidung des Bundesgerichtshofs, dass im Strafrecht nicht immer alles so ist, wie es auf den ersten Blick scheint und sich eine Verteidigung auch instanzübergreifend regelmäßig lohnt!
Selbstverständlich wird sich die Angeklagte vorliegend zumindest weiterhin wegen der gefährlichen Körperverletzung gem. §§ 223 I, 224 Abs. 1 Nr. 2 StGB wegen des Einsatzes von Pfefferspray zulasten der Geschädigten zu verantworten haben. Das Strafmaß für eine gefährliche Körperverletzung liegt allerdings mit 6 Monaten bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe beträchtlich unter dem eines besonders schweren Raubes nach § 250 Abs. 2 Nr. 1 StGB, welcher von einer Mindestfreiheitsstrafe von 5 Jahren ausgeht (BGH, Beschluss April 2019 – 1 StR 37/19)
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
In dem vom OLG Celle zu verhandelnden Fall trank der Angeklagte mit seinem Freund nach einem Fußballspiel Alkohol, ohne dass die Menge des Alkoholkonsums und eine etwaige „Trinkbeteiligung“ des Freundes nachträglich noch festgestellt werden konnte.
Später auf dem Heimweg verursachte der relativ fahruntüchtige Angeklagte (0,88 g Promille) aufgrund überhöhter Geschwindigkeit einen Verkehrsunfall, bei dem sein Freund zu Tode kam. Der Angeklagte wurde aufgrund seines Sorgfaltspflichtverstoßes wegen fahrlässiger Tötung gem. § 222 StGB in Tateinheit mit fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs gem. § 315 Abs. 3, Abs. 1 Nr. 1a StGB zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung verurteilt. Das LG legte die Freiheitsstrafe sodann auf ein Jahr und drei Monate fest und setzte deren Vollstreckung zur Bewährung aus, nachdem der Angeklagte Berufung eingelegt hatte. Die hiergegen gerichtete Revision der StA vor dem OLG führte letztlich zur Aufhebung des LG-Urteils.
Das OLG bemängelte in seinem Urteil die vom LG vorgenommene Strafzumessung. Grund hierfür war, dass das LG u.a. die alkoholintoxikationsbedingte Enthemmung des Angeklagten als einen bestimmenden Strafmilderungsgrund gewertet hatte, was nach Ansicht des OLG einen Rechtsfehler darstellte. Wenn der Täter seinen Trunkenheitszustand vorwerfbar selbst herbeiführe und dadurch eine Enthemmung aufweise, die im Ergebnis die Grundlage für eine fährlässige Tötung bilde, so könne eben diese Enthemmung nicht als strafmildernder Umstand gewertet werden. Vielmehr sei sie ein die Schuld des Angeklagten begründender Umstand, weil die tödliche Fahrweise des Angeklagten gerade auf die Alkoholisierung und dadurch bedingte Enthemmung sowie Selbstüberschätzung zurückzuführen sei.
Darüber hinaus betrachtete das OLG den Umstand, dass der Täter Alkohol in dem Bewusstsein zu sich nahm, später noch ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen, als eigenständigen strafschärfenden Umstand (OLG Celle, Urteil vom 09.12.2019, 3 Ss 48/19).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
In dem zunächst vom AG Hannover zu verhandelnden Fall wurde dem Angeklagten 2005 die ihm 2003 erteilte deutsche Fahrerlaubnis von der Behörde bestandskräftig entzogen. 2008 erwarb er in Polen einen polnischen Führerschein der Klasse B, welcher ihm jedoch 2012 vom AG Hannover durch Strafbefehl entzogen wurde, verbunden mit einer Sperrfrist für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis.
Daraufhin gab der Angeklagte in Polen eine Verlustanzeige für seinen polnischen Führerschein aus dem Jahr 2008 ab und erlangte dort auf diese Weise 2013 einen neuen. Allerdings enthielt dieser im Gegensatz zum ersten polnischen Führerschein eine Befristung. In den Jahren 2016 und 2017 fuhr er dann mit seinem PKW auf Hannovers öffentlichen Straßen und zeigte bei den Polizeikontrollen seinen im Jahr 2013 erworbenen polnischen Führerschein vor.
Nachdem das AG den Angeklagten vom Tatvorwurf des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zweimal freigesprochen hatte, hob das LG Hannover nach Berufungseinlegungen seitens der StA die erstinstanzlichen Urteile auf und verurteilte den Angeklagten wegen fahrlässigen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gem. § 21 Abs. 2 Nr. 1, Abs. 1 Nr. 1 StVG. Die hiergegen gerichtete Revision des Angeklagten vor dem OLG Celle war zumindest teilweise erfolgreich und führte zur Aufhebung des LG-Urteils sowie Zurückverweisung an das LG zur erneuten Verhandlung und Entscheidung.
Das OLG Celle stimmte dem LG zu, dass der Angeklagte zum Zeitpunkt der Taten in den Jahren 2016 und 2017 keine deutsche Fahrerlaubnis besessen habe, da diese ihm bereits entzogen worden war.
Der polnische Führerschein von 2013 führe nicht zur Berechtigung zum Führen von Kraftfahrzeugen im öffentlichen Verkehr in Deutschland, da es sich hierbei nicht um eine neue Fahrerlaubnis handele, sondern um einen Ersatzführerschein für den polnischen Führerschein aus dem Jahr 2008, den der Angeklagte in Polen als abhanden gekommen gemeldet hatte. Hierfür spräche die Tatsache, dass die Spalte 12 des Führerscheins von 2013 die Eintragung des Codes „71“ enthalte, welche auf ein Duplikat eines bereits ausgestellten Führerscheins hinwiese (vgl. Anhang I der 3. EU-Führerschein-Richtlinie (2006/126/EG)). Daran ändere auch die Tatsache nichts, dass dieser Ersatzführerschein anders als der Führerschein von 2008 erstmalig eine Befristung nach Art. 7 Abs. 2a der 3. FS-RL enthalte. Dieser Fall unterscheide sich zudem von dem Fall, in dem der Führerschein im Wege des Umtauschs einer in Deutschland erteilten Fahrerlaubnis durch einen anderen EU-Mitgliedsstaat nach Art. 11 Abs. 2 der 3. FS-RL erteilt wird und dieser daher als neue Fahrerlaubnis eingestuft werden könne (vgl. OLG Zweibrücken, Beschluss vom 18.01.2016, 1 Ss 106/15).
Ferner sei zu beachten, dass dem Angeklagten die von Polen als einem anderen EU-Mitgliedstaat ausgestellte Fahrerlaubnis von 2008 durch den Strafbefehl in Deutschland nach § 69 Abs. 1 StGB rechtskräftig entzogen worden und zeitgleich eine Sperrfrist für die Erteilung einer neuen Fahrerlaubnis nach § 69a Abs. 1 StGB angeordnet worden war, ohne dass ihm nach Ablauf dieser Frist das Recht zur Teilnahme am öffentlichen Verkehr in Deutschland wiedererteilt worden wäre. Der polnische Führerschein, der dem Angeklagten 2013 von Polen als Ersatzführerschein für die entzogene polnische Fahrerlaubnis von 2008 nach Art. 11 Abs. 5 der 3. FS-RL ausgestellt wurde, berechtige nicht zur Teilnahme am öffentlichen Verkehr in Deutschland, vgl. § 28 Abs. 1 S. 1, Abs. 4 Nr. 3 FeV (OLG Celle, Beschluss vom 12.12.2019, 2 Ss 138/19).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
In dem vom KG Berlin zu verhandelnden Fall fuhr der Angeklagte mit überhöhter Geschwindigkeit durch Berlins Innenstadt, wobei er mehrere Überholungsmanöver durchführte und an einer Straßenbahn-Haltestelle auch keinerlei Rücksicht auf ggf. die Fahrbahn überquerende Personen nahm.
Das AG Tiergarten ging davon aus, dass das Ansinnen des Angeklagten gewesen sei, „unter großer Missachtung einer angemessenen Geschwindigkeit in den konkreten Verkehrssituationen und der vorherrschenden Verkehrslage über eine Fahrtstrecke von mindestens 1,8 Kilometern eine möglichst hohe Geschwindigkeit zu erreichen, um als Pizzalieferant auf schnellstem Weg zu seinem Fahrziel zu gelangen.“ Es verurteilte den Angeklagten daher wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens / Alleinrennen gem. § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB. Die hiergegen gerichtete Revision des Angeklagten vor dem KG war erfolgreich und führte zur Aufhebung des AG-Urteils sowie Zurückverweisung an das AG zur erneuten Verhandlung und Entscheidung.
Das KG stellte zunächst klar, dass § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB nicht verfassungswidrig sei, da insbesondere kein Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot des Art. 103 Abs. 2 GG ersichtlich sei.
Gem. o.g. Vorschrift macht sich strafbar, wer sich im Straßenverkehr als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
Das KG hielt fest, dass § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB nach dem Willen des Gesetzgebers als abstraktes Gefährdungsdelikts den Alleinraser / das Alleinrennen im Blick habe, der ein Kraftfahrzeugrennen objektiv und subjektiv gewissermaßen gegen sich selbst nachstelle. Insofern sei bei der Tatbestandsauslegung der Fokus auf die Umstände zu legen, aus denen die besondere Gefährlichkeit von Kraftfahrzeugrennen resultiere. Dabei sei an die waghalsigen Fahrweisen der Rennteilnehmer zu denken, bei denen jegliche Fahr- und Verkehrssicherheit außer Acht gelassen werde und mit denen regelmäßig die Gefahr oder auch das Inkaufnehmen des Kontrollverlustes über das Fahrzeug zugunsten eines Geschwindigkeitszuwachses zulasten anderer Verkehrsteilnehmer einhergehe.
Angesichts dessen sollen bloße Geschwindigkeitsüberschreitungen gerade nicht von der Strafbarkeit nach o.g. Norm erfasst sein. Vielmehr sollen nur solche Handlungen unter Strafe gestellt werden, die „objektiv und subjektiv aus der Menge der bußgeldbelegten Geschwindigkeitsverstöße herausragen.“ Was das subjektive Tatbestandsmerkmal anbelangt, so müsse der Täter mit der Absicht handeln, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen. Die Urteilsgründe müssten im Ergebnis also „konkrete Feststellungen zu den Umständen sowie dem Vorstellungsbild des Täters enthalten, die sein Verhalten von bloßen bußgeldbewehrten Verkehrsverstößen abheben und diesen den Charakter eines nachgestellten Kraftfahrzeugrennens geben.“
Vorliegend konnten nach Ansicht des KGs weder die objektiven Tatbestandsmerkmale einer nicht angepassten Geschwindigkeit bzw. der groben Verkehrswidrigkeit und Rücksichtslosigkeit, noch das subjektive Absichtsmerkmal entgegen der Einschätzung des AGs sicher festgestellt werden, sodass der Tatbestand des § 315d Abs. 1 Nr. 3 StGB und damit ein sog. Alleinrennen letztlich nicht gegeben war (KG Berlin, Beschluss vom 20.12.2019, (3) 161 Ss 134/19 (75/19)).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
In dem vom OLG Zweibrücken zu verhandelnden Fall stieß die Angeklagte mit einem von ihr geführten PKW auf einem privaten Parkplatz gegen ein anderes Kraftfahrzeug und verursachte einen hohen Fremdschaden.
Daraufhin entfernte sie sich im Bewusstsein vom Unfallort, einen Unfall verursacht zu haben, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ihrer Person zu ermöglichen. Die Angeklagte wurde daher vom AG wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gem. § 142 Abs. 1 Nr. 1 StGB zu einer Geldstrafe verurteilt. Ferner wurde ihr die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist von fünf Monaten angeordnet. Die hiergegen gerichtete Revision der Angeklagten war erfolgreich und führte zur Aufhebung des AG-Urteils sowie Zurückverweisung an das AG zur erneuten Verhandlung und Entscheidung.
Der Unfall muss sich gem. § 142 Abs. 1 StGB im öffentlichen Straßenverkehr ereignet haben. Ein Verkehrsraum ist öffentlich, „wenn er entweder ausdrücklich, oder mit stillschweigender Duldung des Verfügungsberechtigten für jedermann, oder aber zumindest für eine allgemein bestimmte größere Personengruppe zur Benutzung zugelassen ist und auch so benutzt wird.“
Im vorliegenden Fall war die Angeklagte Mieterin eines Stellplatzes auf o.g. Parkplatz, welcher als Privatparkplatz gekennzeichnet war. Die Ein- und Ausfahrt war nur durch das Passieren einer Schrankenanlage möglich, welche jedoch bereits vor dem Tatzeitpunkt defekt war. Dies hatte zur Folge, dass der Parkplatz frei zugänglich war und des Öfteren auch von Nicht-Mietern genutzt wurde.
Angesichts dieser Umstände ging das AG von der Öffentlichkeit des Parkplatzes aus. Als Begründung wurde angeführt, dass der Eigentümer des Parkplatzes trotz anderweitiger Zweckbestimmung tatsächlich nicht verhindert habe, dass der Parkplatz auch der Allgemeinheit zugänglich war.
Nach Ansicht des OLG erfolgte jedoch keine rechtsfehlerfreie Begründung durch das AG hinsichtlich der Öffentlichkeit des Parkplatzes. Es wies darauf hin, dass es für die Beurteilung der Frage nach der Duldung auf den für etwaige Benutzer erkennbaren äußeren Willen des Verfügungsberechtigten ankomme und nicht auf dessen inneren Willen. Im vorliegenden Fall reiche „allein der Umstand, dass der Grundstückseigentümer nicht „tatsächlich“ verhindert [habe], dass auch die Allgemeinheit den Parkplatz befahren konnte“ nicht aus, um von einer stillschweigenden Duldung des Eigentümers als Verfügungsberechtigten auszugehen und somit die Verkehrsfläche als öffentlich einzustufen. Vielmehr ist zu beachten, dass der Parkplatz durch eine Beschilderung als Privatparkplatz gekennzeichnet war. Zudem installierte der Eigentümer bewusst eine Schrankenlage mit dem Zweck, die Einfahrt auf einen eng bestimmten Nutzerkreis zu begrenzen. Aus der Tatsache, dass die Schrankenanlage bereits vor dem Tatzeitpunkt über längere Zeit hin defekt war und damit Absperrmaßnahmen fehlten, die Nichtberechtigten den Zugang unmöglich machten, darf nicht zwangsläufig die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die private Parkplatzfläche der Allgemeinheit uneingeschränkt zur Verfügung stand.
Darüber hinaus wurde jedem Mieter ein Stellplatz fest zugewiesen, sodass auch hieran deutlich wird, dass der Verfügungsberechtigte daran interessiert war, dass diese Stellplätze nicht durch Nicht-Mieter besetzt wurden. Insgesamt machte der Eigentümer des Parkplatzes damit nach außen hin deutlich, dass sein Wille in Richtung „Nicht-Nutzung“ durch die Allgemeinheit ging. Die gelegentliche Benutzung durch Nichtberechtigte ändert daher an der Nicht-Öffentlichkeit dieser Verkehrsfläche nichts, sodass das Tatbestandsmerkmal der Öffentlichkeit des Straßenverkehrs nach § 142 Abs. 1 StGB nicht erfüllt ist (OLG Zweibrücken, Beschluss vom 11.11.2019, 1 OLG 2 Ss 77/19).
Das Urteil der I. Instanz war durch Freispruch aufzuheben.
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Die Richter des Verwaltungsgerichtes Mainz mussten sich im November des Jahres 2019 mit der sogenannten Fahrtenbuchauflage beschäftigen, welche Verkehrssündern auferlegt werden kann, wenn die Feststellung des Fahrzeugführers nach einem Verstoß gegen die Verkehrsvorschriften nicht möglich war. In diesem müssen die Fahrzeugführer ihre Abfahrtsorte sowie die Fahrzeit eintragen, um künftige Verkehrsverstöße ohne Schwierigkeiten für Behörden ahndbar zu machen.
Im folgenden Beschluss wurde darüber entschieden, ob es als Fahrzeugführereigenschaft ausreiche, wenn man als Adressat des Anhörungsbogens diesen bestreite. Des Weiteren wurde das Ermessen bezüglich der zeitlichen Länge der Auflage abgewogen.
Folgender Sachverhalt liegt zugrunde:
Ein auf den Antragsteller zugelassenen PKW überschritt die außerorts zulässige Höchstgeschwindigkeit um 34 km/h. Die Polizeibehörde versuchte vergebens, den verantwortlichen Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt ausfindig zu machen, etwa durch etwaige Hausbesuche und behördliche Lichtbildabgleiche, jedoch war eine eindeutige Identifizierung des Fahrers war jedoch nicht möglich. Nach telefonischem Erreichen des Halters stritt dieser seine Mitwirkung an der Ordnungswidrigkeit ab.
Daraufhin ordnete die Antragsgegnerin unter Sofortvollzug die Führung eines Fahrtenbuches für die Dauer von 15 Monaten an. Dagegen wendet sich der Antragsteller mit einem Eilantrag, in welchem er sich gegen die Auflage wehrt. Er argumentiert, dass er niemals einen Anhörungsbogen der Behörde erhalten habe und in dem Telefonat mit den Beamten keinerlei Angaben über den Tatvorwurf erfahren zu haben.
Das Verwaltungsgericht Mainz lehnt den Eilantrag mit folgender Begründung ab.
- Allein die erhöhte Eintragungsanzahl im Verkehrszentralregister lasse die Verhängung einer Fahrtenbuchauflage gegen den Fahrzeughalter zu, weil durch diese die Schwere der Verkehrsverstöße zum Tragen kommt.
- Die Polizeibehörde habe alles Erforderliche getan, um die Identität des Fahrzeugführers zu ermitteln. Durch das Telefonat mit dem Fahrzeughalter hätte sich die Chance ergeben, die Fahrzeugführereigenschaft einzuräumen oder detailliertere Angaben zu machen. Dies wurde jedoch vom Antragsteller unterlassen.
- Angesichts des Maßes der Geschwindigkeitsüberschreitung, der hohen Punkteanzahl im Verkehrszentralregister, der Gefahr der Wiederholung sowie der fehlenden Aufklärungsbereitschaft sei eine Anordnung der Fahrtenbuchauflage über 15 Monate ermessensgerecht. Diese Auflage soll die Ahndung künftiger Verkehrsverstöße ermöglichen, welche durch den Fahrzeughalter aufgrund seiner Vergangenheit erwartet werden können.
- Die Auflage war auch kein Fall der Ermessensüberschreitung, denn der Fahrzeughalter hätte genug Möglichkeiten gehabt, eine Fahrzeugführeridentifikation preiszugeben.
(Verwaltungsgericht Mainz, Beschluss vom 08.11.2019 – 3 L 1039/19.MZ)
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat mit einem Urteil vom 13.11.2019 für einen großen Wirbel in der Verkehrsrechtsszene gesorgt. Die Richter des OVG haben die umstrittene „Section-Control“-Verkehrsüberwachung auf der B6 als rechtmäßig eingestuft, was zur Folge hatte, dass diese ab dem 14.11.2019 wieder für viele Bußgeldbescheide verantwortlich ist.
Diese sogenannte „Section-Control“ (zu Deutsch: Abschnittskontrolle) enthält die Besonderheit, dass nicht wie sonst üblich an einer festen Stelle eine Messung vorgenommen wird, sondern die Messung durch eine Durchschnittsgeschwindigkeitsberechnung auf einer Länge von rund zwei Kilometern stattfindet. Rechtlich problematisch an diesem Messsystem zeigt sich, dass nicht nur Fotoabgleiche und Daten von Verkehrssündern übertragen werden, sondern von pauschal jedem Autofahrer, welcher die Section-Control mit seinem Kraftfahrzeug befährt.
Das Verwaltungsgericht in erster Instanz untersagte damals die Anwendung solcher Systeme, da nach der Ansicht der Richter das durch die pauschale Datenübertragung in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung eingegriffen werde. Dies erfordere einen Gesetzesvorbehalt, welcher jedoch zum Zeitpunkt der Entscheidung im März 2019 noch nicht vorlag.
Gegen das damalige Urteil ging die Polizeidirektion Hannover in Berufung. Zur Begründung führte Sie an, dass es seit Ende Mai 2019 zu einer Sachverhaltsänderung kam, denn ab diesem Zeitpunkt galt der frisch wirksam gewordene § 32 Abs. 7 NPOG, welcher von nun an die erforderliche gesetzliche Eingriffsermächtigung für die sogenannte Abschnittskontrolle einführte. Durch die Berufung musste der Zeitpunkt der Sachverhaltsaufklärung bis zur letzten mündlichen Verhandlung am Verwaltungsgericht neu aufgerollt werden, welcher im späten September stattfand.
Das Niedersächsische OVG folgte der Argumentation der Polizeidirektion und änderte das Urteil des Verwaltungsgerichtes zugunsten der Section-Control. An der Verfassungsmäßigkeit des § 32 Abs. 7 NPOG bestand nach Ansicht der Richter kein Zweifel, somit bestand eine gültige gesetzliche Ermächtigungsgrundlage für die Pilotanlage auf der B6 zwischen Gleidingen und Laatzen.
Den Bedenken bezüglich des Eingriffes in die informationelle Selbstbestimmung wandte man sich mit der Argumentation entgegen, dass es den Autofahrern freistehe, den durch die Medien nun wohl bekannten Abschnitt der Bundesstraße zu nutzen und so eine Art Einwilligung in die datenschutzrechtlichen Informationsrechte konstruiert werden (Niedersächsisches Oberverwaltungsgericht, Urteil vom 13.11.2019 – 12 LC 79/19).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Im folgenden Beschluss vom 22.11.2019 mussten sich die Richter des Verwaltungsgerichtes Mainz mit den Konsequenzen der epileptischen Krankheit in Verbindung mit dem Straßenverkehr auseinandersetzen.
Der Sache liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Antragsteller hatte in seiner Krankheitshistorie des öfteren mit epileptischen Anfällen zu kämpfen, welche ihn ohne Vorsymptome übermannten. Nach einer epilepsiechirurgischen Operation konnten diese weitestgehend eingedämmt werden, der Antragsteller war zunächst anfallsfrei. Aufgrund dieses Zustandes wurde ihm die Fahrerlaubnis zum Führen von Kraftfahrzeugen erteilt.
Während einer Korrespondenz mit dem Gesundheitsamt gab dieser jedoch an, dass er seit kurzer Zeit wohl wieder „etwa einmal im Monat“ einen Krampfanfall erleidet. Dies leitete das Gesundheitsamt an die zuständige Führerscheinbehörde weiter.
Diese forderte den Antragsteller zur Vorlage eines fachärztlichen Gutachtens über seine Fahreignung auf. Dieses wurde jedoch zur angegebenen Frist nicht eingebracht. Aufgrund dieser Umstände drohte der Entzug der Fahrerlaubnis durch die Behörde.
Dagegen wehrte sich der Antragsteller mit einem gerichtlichen Eilantrag und legte ärztliche Stellungnahmen vor, welche ihm eine mehrjährige Anfallsfreiheit ohne Medikation belegen. Desweiteren sei seine Fahrerlaubnis unabdinglich für den Erhalt seines jetzigen Arbeitsplatzes.
Das Verwaltungsgericht lehnte den Eilantrag ab. Dies wird damit begründet, dass die Fahrerlaubnis zwingend und ohne private Berücksichtigung privater Nachteile zu entziehen ist, wenn sich der Inhaber als ungeeignet erweise. Aufgrund der Epiliepsie und dessen Auswirkung kann eine Fahreignung nur ausnahmsweise dann angenommen werden, wenn kein wesentliches Risiko von Anfallswiederholungen mehr bestehe. Dies ist vor allem hier aufgrund der erst kürzlich gestarteten Serie von Neuanfällen auszuschließen.
Dies wurde auch seitens eines angeforderten und dann abgelegten Facharztgutachten bestätigt.
Es war rechtmäßig, die Fahrerlaubnis zu entziehen, auch wenn ein zuvor längerfristiger Zeitraum bestand, in welchem keine Anfälle aufgetreten sind (VG Mainz, Beschluss vom 22.11.2019 – 3 L 1067/19.MZ).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Bayerische Oberste Landesgericht hat sich im Oktober 2019 erneut bezüglich des umstrittenen Falles des sogenannten „Containern“ sowie dessen Strafbarkeit geäußert.
Dem Fall liegt folgender, simpler Sachverhalt zugrunde:
Zwei Studentinnen begaben sich in die Anlieferungszone eines EDEKA-Kaufhauses in Olching. Dort öffneten sie mit Hilfe eines mitgebrachten Vierkantschlüssels einen vom Lebensmittelladen versperrten Container, in welchem „weggeworfene“ Lebensmittel für die Abholung durch ein Entsorgungsunternehmen bereitgestellt wurden. Nach Öffnung des Schlosses entwendeten die Angeklagten verschiedene Lebensmittel.
Das erstinstanzliche Amtsgericht Fürstenfeldbruck verurteilte die Angeklagten wegen vollendetem Diebstahl zu einer Geldstrafe von 225 €.
Diese wandten sich mit einer Revision zum BayOLG, mit der Argumentation, dass die Lebensmittel während der Wegnahmehandlung bereits nicht mehr „fremd“ waren, sondern vom Lebensmittelmarkt „aufgegeben“ wurden und sowieso entsorgt werden müssten (Derelektion).
Das Bayerische Oberste Landesgericht verwarf die auf Verletzung materiellen Rechts gestützte Revision der Angeklagten als unbegründet und bestätigte die Verurteilung zum Diebstahl nach § 242 Abs. 1 StGB.
Die Richter führten folgende Begründung an: Die Lebensmittel standen zum Zeitpunkt der Wegnahme im Eigentum der Firma EDEKA. Zwar seien diese zur Abholung durch ein Entsorgungsunternehmen separiert worden, jedoch wird damit nicht auch automatisch das Eigentum aufgegeben. Als starkes Indiz dafür soll auch der verschlossene Container gelten, welcher eine Derelektion offensichtlich ausschließe, was die Angeklagten nach der Verkehrsauffassung hätten bemerken müssen.
Die Lebensmittel seien in dieser Form lediglich dem Entsorgungsunternehmen und keinem Dritten zur Verfügung zu stellen. Dies ergebe sich auch daraus, dass die Firma EDEKA für ALLE Lebensmittel bezüglich ihrer gesundheitlichen Unbedenklichkeit einzustehen hat, welche sie in den Verkehr bringt. Durch den Verfall/Ungenießbarkeit der Lebensmittel müssen diese ordnungsgemäß durch ein beauftrages Unternehmen entsorgt werden, nur so könne sich EDEKA Haftungsproblematiken entziehen.
Dieses Urteil zeigt, dass strafrechtliche Tücken selbst in den harmlosesten Situationen lauern können. Falls Sie durch solch einen Fall belastet werden, ist es unabdingbar, Akteneinsicht bei einem erfahrenen Strafrechtsanwalt beantragen zu lassen und ihren Fall umfänglich zu prüfen.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht