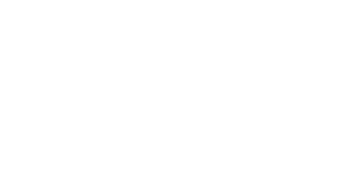Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Das LG Dortmund hatte aufgrund einer Beschwerde des Beschwerdeführers (nachfolgend: BF) gegen den Beschluss des AG Dortmund vom 03.01.2019 beschlossen, dass dieser angesichts der Zulässigkeit und Begründetheit der Beschwerde aufzuheben und dem BF trotz des dringenden Tatverdachts der Begehung einer Straftat nach § 142 StGB sein Führerschein wieder auszuhändigen ist.
§ 69 Abs. 1 Satz 1 StGB normiert, dass das Gericht demjenigen die Fahrerlaubnis entzieht, der wegen einer rechtswidrigen Tat, die dieser bei oder im Zusammenhang mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs begangen hat, verurteilt wird. Voraussetzung für die Entziehung ist aber, dass sich aus der Tat ergibt, dass der Täter zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet ist.
Ist die rechtswidrige Tat i.S.d. Abs. 1 ein Vergehen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort (§ 142 StGB), so ist der Täter in der Regel als zum Führen von Kraftfahrzeugen ungeeignet anzusehen, wenn er weiß oder wissen kann, dass bei dem Unfall ein Mensch getötet oder nicht unerheblich verletzt worden oder an fremden Sachen bedeutender Schaden entstanden ist, vgl. § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB (sog. Regelbeispiel).
Das LG befasste sich hier zum einen mit der für die Annahme eines bedeutenden Sachschadens erforderlichen Überschreitung der Wertgrenze. Es äußerte Zweifel daran, ob hierfür noch auf die Wertgrenze von 1.300 Euro oder nicht vielmehr, wie es andere Gerichte handhaben, auf eine Grenze von 1.500 Euro abgestellt werden müsse, ließ die Frage am Ende aber offen. Jedenfalls war letztere Grenze vorliegend nicht erreicht.
Zum anderen hegte das Gericht Zweifel an der Erfüllung der Vorsatzanforderungen nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB, also daran, ob der BF wusste oder wissen konnte, dass an dem geschädigten Pkw als fremde Sache ein bedeutender Sachschaden eingetreten war. Im konkreten Fall hatte der Beifahrer des BF den Pkw inspiziert. Zwar müsse sich der BF die Kenntnis seines Beifahrers zurechnen lassen, doch könne auch bei der Unterstelllung einer „Begutachtung“ durch diesen nicht sicher festgestellt werden, dass ein bedeutender Schaden als Laie hätte erkannt werden können. Schließlich sprachen die Lichtbilder vom geschädigten Pkw aus Laiensicht eher für einen oberflächlichen und damit geringen Sachschaden. Auch die Polizei bezifferte den Schaden am Tatort nur mit 1.200 Euro, sodass nicht einmal die o.g. Wertgrenze von 1.300 Euro erreicht wurde. Zudem kam dem BF hier zugute, dass er eine potentielle Regulierung über die Haftpflichtversicherung ermöglichte, indem er sich mit dem Geschädigten telefonisch in Kontakt setzte und seine Fahrereigenschaft zugab (LG Dortmund, Beschluss vom 25.03.2019, 32 Qs-264 Js 2201/18-35/19).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das LG Berlin hatte in einem Fall zu entscheiden, in dem der Angeklagte mit einem 605 PS motorisierten Mietwagen mit einer Mindestgeschwindigkeit von 150 km/h über eine Strecke von zumindest 3,8 km durch die Innenstadt Berlins raste, obwohl die innerorts zulässige Höchstgeschwindigkeit 50 km/h betrug. Dabei wollte er sich profilieren und imponieren. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch aggressivruckartiges Lückenspringen des Angeklagten zum Abbremsen gezwungen. Er wurde daraufhin wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens nach § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB verurteilt. Die gegen dieses Urteil vom 04.12.2018 gerichtete Revision wurde vom KG Berlin verworfen.
Das Gericht merkte an, dass der subjektive Tatbestand des § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB mit seiner Formulierung „um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“ kein „volles Ausreizen“ eines Kraftfahrzeugs, also kein tatsächliches Fahren mit der fahrzeugspezifisch höchstmöglichen Geschwindigkeit voraussetze. Anderenfalls würde dies eine unangemessene Begünstigung desjenigen Täters nach sich ziehen, „der ein hochmotorisiertes Fahrzeug führt und sehr hohe Geschwindigkeiten erreicht, ohne an das Limit der technischen Leistungsfähigkeit zu gehen.“ Vielmehr stelle das Gesetz auf die „relativ höchstmöglich erzielbare Geschwindigkeit“ ab, worunter eine Zusammenfassung der fahrzeugspezifischen Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit (wobei der Witterungsbedingungen zu verstehen sei. § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB hat den Alleinraser im Blick, der ein Kraftfahrzeugrennen gewissermaßen gegen sich selbst nachstellt. Durch die zuvor genannten Punkte manifestiere sich der nachgestellte Renncharakter und es würden gerade nicht reine Geschwindigkeitsüberschreitungen unter Strafe gestellt werden.
Trotz des Hinweises auf die nötige zurückhaltende Anwendung des § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB kam das KG vorliegend zu dem Ergebnis, dass aufgrund des außergewöhnlichen Tatgeschehens sowohl der objektive („nicht angepasste Geschwindigkeit“) als auch subjektive Tatbestand („um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen“) erfüllt seien (Kammergericht Berlin, Beschluss vom 15.04.2019, (3) 161 Ss 36/19 (25/19)).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Mit Urteil vom 15.11.2018 hatte das Amtsgericht München über ein Beweisverwertungsverbot im Bereich dem Telekommunikationsüberwachung zu entscheiden.
Der Entscheidung lag nach Anklage folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte soll im Raum Dachau einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln – Marihuana und Kokain – betrieben haben, ohne die hierfür erforderliche Erlaubnis zu haben. Davon wollte sich der Angeklagte eine fortlaufende Einnahmequelle von einigem Umfang und gewisser Dauer verschaffen, dh. Gewinn erzielen.
In der Hauptverhandlung konnte der Tatnachweis nicht geführt werden, da die Erkenntnisse aus dem Beschluss zur Telekommunikationsüberwachung rechtswidrig erlangt wurden.
Denn die Staatsanwaltschaft beantragte in dem Beschluss, dass der Angeklagte dem anderweitig verfolgten H. ernsthaft und verbindlich den Verkauf von 9 Kilo Marihuana zu einem nicht näher bekannten Preis zugesagt habe.
Dieser Antrag beruht jedoch auf einem falsch dargestellten Sachverhalt. Denn diese Tatsachenlage entsprach nicht der damaligen Aktenlage. Eine solche Äußerung ist weder dem Vermerk der Akte noch aus dem Protokoll der Telekommunikationsüberwachung zu entnehmen.
Eine ernsthafte und verbindliche Verkaufszusage hat zu keinem Zeitpunkt vorgelegen.
Damit waren die Protokolle der Telekommunikationsüberwachung unverwertbar und beruhten auf einem Beweisverwertungsverbot, da eine falsche Tatsachengrundlage herangezogen wurde.
Diese Entscheidung zeigt, dass Beweisverwertungsverbote nicht nur auf Ebene der Revision eine Rolle spielen. Vielmehr muss der Weg für den Mandanten zum Freispruch bereits auf amtsgerichtlicher Ebene beschritten und das Fehlverhalten staatlicher Strafverfolgungsorgane gerügt werden.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Der zweite Senat für Strafsachen des Bundesgerichtshofes in Karlsruhe musste sich im Juli 2018 mit den Grundsätzen der Strafprozessordnung, insbesondere mit dem Beweisverwertungsverbot auseinandersetzen. Obwohl dies fest verankerte Dogma der StPO allgemein bekannt ist, ist dies dennoch nicht in jeder Situation starr anzuwenden.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein Mann wurde im Juli 2017 vom Landgericht Stralsund aufgrund einer Vergewaltigungstat zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 6 Monaten verurteilt. Die Verurteilung des Gerichts stützte sich weitestgehend auf Zeugenaussagen. Eine entscheidende davon stellte die eines Polizeibeamten dar, welcher zufällig ein Gespräch zwischen dem Angeklagten und seinem Verteidiger bei einem Haftprüfungstermin auf dem Gerichtsflur mithörte. Bei der Besprechung soll es sich wohl um die explizite und ausführliche Erklärung des Vorgangs durch den Angeklagten während der Vergewaltigung handeln, welche er versuchte, dem Verteidiger zu schildern. Der Polizeibeamte sagte dies dann im Prozess aus. Der Beschuldigte hielt die Verwertung der Aussage für unzulässig, da die Kommunikation zwischen einem Beschuldigten und seinem Anwalt rechtlich streng geschützt sei. Es folgt die Revision an den Bundesgerichtshof.
Dieser wies die Revision des Beschuldigten überraschend zurück und begründete dies folgendermaßen: Zwar sei die Kommunikation zwischen einem Angeklagten sowie seinem bestellten Verteidiger durchaus rechtlich geschützt. Dieser rechtliche Schutz beschränkt sich jedoch wesentlich auf die Überwachung durch staatliche Organe. Dies sei im folgenden Fall jedoch gerade nicht der Fall gewesen, denn die Vertraulichkeit der Kommunikation werde nicht durch Strafverfolgungsorgane verletzt, wenn der Beschuldigte in offensichtlicher Anwesenheit eines Ermittlungsbeamten gegenüber dem Verteidiger brisante Details in erhöhter Lautstärke wiedergibt, dass solche ohne Weiteres von Dritten wahrgenommen werden können.
Dies führt zur Konsequenz, dass der rechtliche Schutz vor der staatlichen Überwachung hier nicht greift und die vom anwesenden Polizeibeamten wahrgenommenen Äußerungen durchaus im Strafverfahren als Beweismittel verwendet werden können (BGH, Urteil vom 04.07.2018 – 2 StR 485/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
In dem vom AG Tecklenburg zu verhandelnden Fall übersah der angeklagte PKW-Fahrer in der Dunkelheit aus Unachtsamkeit den auf der Fahrbahn liegenden Geschädigten und überrollte diesen. Er verstarb an den Folgen seiner Verletzungen, die er durch das Überrollen erlitt. Der Angeklagte wurden daher wegen fahrlässiger Tötung gem. § 222 StGB verurteilt. Die Revision vor dem OLG Hamm blieb erfolglos.
§ 222 StGB setzt eine Sorgfaltspflichtverletzung des Täters voraus, die hier in der Verletzung des Sichtfahrgebotes nach § 3 Abs. 1 Satz 4 StVO i.V.m. § 1 StVO gesehen wurde. Es wurde auf Basis eines Sachverständigengutachtens festgestellt, dass der Angeklagte angesichts der Stärke der Straßenbeleuchtung und seiner Fahrzeugbeleuchtung bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt, insbesondere bei aufmerksamer Beobachtung des vor seinem PKW befindlichen Straßenbereichs, den auf der Fahrbahn liegenden Geschädigten jedenfalls auf einer Distanz von 27 Metern rechtzeitig hätte erkennen können und zudem bei Einhaltung der innerorts zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h sowie sofortiger Vollbremsung – unter Zubilligung einer Vorbremszeit von 1 Sekunde und einer Bremsverzögerung von 7,5m/s² – den PKW rechtzeitig hätte zum Stehen bringen können. Ein Überrollen und damit die Tötung des Geschädigten hätten auf diese Weise vermieden werden können. Die Tatsache, dass der Angeklagte mit dem auf der Straße liegenden Geschädigten nicht rechnen musste, schränke das Sichtfahrgebot nicht ein, denn ein PKW-Fahrer müsse bei Dunkelheit so fahren, dass er sein Fahrzeug noch vor einem Hindernis, auch in Form eines Fußgängers, anhalten könne.
Darüber hinaus wurde im konkreten Fall ein Mitverschulden des Geschädigten mit der Folge des Ausschlusses der Voraussehbarkeit des Unfalls für den Täter abgelehnt, da ein solches nur angenommen werden könne, wenn es in einem gänzlich vernunftwidrigen oder außerhalb der Lebenserfahrung liegenden Verhalten des Geschädigten läge. Es läge aber nicht außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung, dass, wie hier, eine volltrunkene Person mit einer BAK von 3,36 ‰ zum Todeszeitpunkt nach einer Feier beim Überqueren einer Straße stürze und dort liegen bleibe. Zudem sei auch die denkbare Annahme eines gänzlich vernunftwidrigen Verhaltens abzulehnen, da bei der Bewertung eines solchen Verhaltens auf den Zeitpunkt bei Eintritt der kritischen Verkehrssituation, also hier auf den Zeitpunkt, als sich der Angeklagte mit dem PKW dem Unfallort näherte, abgestellt werden müsse. Das bedeutet, es ist ein enger zeitlich-räumlicher Zusammenhang mit dem Unfall erforderlich. In diesem Zeitpunkt war der Geschädigte angesichts seines übermäßigen Alkoholkonsums zu einem vernunftgesteuerten Verhalten jedoch nicht mehr imstande (OLG Hamm, Beschluss vom 18.07.2019, RVs 65/19).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Die bei einem Speditionsunternehmen angestellte Fahrzeugführerin fuhr mit dem LKW, welcher im Eigentum des Speditionsunternehmens als Fahrzeughalterin stand, an einem Karfreitag auf der Straße, um Transportgut von A nach B zu bringen. Aufgrund einer Kontrolle während der Fahrt wurde gegen die Fahrzeugführerin später wegen einer verbotswidrigen LKW-Fahrt an einem gesetzlichen Feiertag eine Geldbuße von 120,00 Euro rechtskräftig festgesetzt.
Auch der Betroffene, der Geschäftsführer des Unternehmens, wurde vom Amtsgericht Bergheim wegen fahrlässiger Anordnung bzw. Zulassung der verbotswidrigen Teilnahme eines LKWs an einem Feiertag am öffentlichen Straßenverkehr zu einer Geldbuße von 400,00 Euro verurteilt.
Gegen dieses Urteil ging der Betroffene mittels Rechtsbeschwerde beim Oberverwaltungsgericht Köln vor. Die Rechtsbeschwerde hatte Erfolg.
Gem. § 30 Abs. 3 Satz 1 StVO dürfen an Sonntagen und Feiertagen in der Zeit von 0.00 bis 22.00 Uhr zur geschäftsmäßigen oder entgeltlichen Beförderung von Gütern einschließlich damit verbundener Leerfahrten Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t sowie Anhänger hinter Lastkraftwagen nicht geführt werden.
Ein Fahrzeug „führt“, „wer es selbst (eigenhändig) bei bestimmungsgemäßer Anwendung seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- oder Mitverantwortung in Bewegung setzt oder unter Handhabung seiner technischen Vorrichtungen während der Fahrtbewegung durch den öffentlichen Verkehrsraum ganz oder wenigstens zum Teil lenkt.“ Demnach war die LKW-Fahrerin zweifelfrei Führerin des LKWs, nicht aber das Speditionsunternehmen bzw. der betroffene Geschäftsführer als Fahrzeughalter, da dieser das Fahrzeug nicht eigenhändig „führte“. Der Fahrzeughalter ist also nicht Adressat dieser Vorschrift.
Allerdings gilt es zu beachten, dass der Fahrzeughalter trotz der fehlenden Feststellung eines eigenhändigen „Führens“ des Fahrzeugs im Einzelfall ebenfalls dadurch ordnungswidrig gehandelt haben kann, indem er sich an einer (vorsätzlichen) Ordnungswidrigkeit in Form des (vorsätzlichen) verbotswidrigen „Führen“ eines Fahrzeugs durch den Fahrzeugführer (vorsätzlich) beteiligt, vgl. § 14 Abs. 1 Satz 1 OWiG.
Eine solche Beteiligung konnte im vorliegenden Fall aber nicht festgestellt werden, da das Amtsgericht Bergheim von einer fahrlässigen Begehung der Ordnungswidrigkeit durch die Fahrzeugführerin ausging und eine fahrlässige Beteiligung an einer fremden Ordnungswidrigkeit begrifflich nicht möglich ist.
Der Wortlaut des § 30 Abs. 3 Satz 1 StVO wurde im Übrigen durch die 53. Verordnung zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 6. Oktober 2017 verändert. Nach der bis zum 18. Oktober 2017 geltenden Fassung durften dem Wortlaut nach Lastkraftwagen mit einer zulässigen Gesamtmasse über 7,5 t an Sonn- und Feiertagen nicht „verkehren“. Dies wurde dahingehend interpretiert, dass auch der Fahrzeughalter bußgeldrechtlich in die Verantwortung genommen werden konnte. Der nun geltende Wortlaut lässt dies, wie dargestellt, nicht mehr zu (OLG Köln, Beschluss vom 15.07.2019, 1 RBs 207/19).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Nach § 21a Abs. 2 Satz 1 StVO muss grundsätzlich während der Fahrt einen geeigneten Schutzhelm tragen, wer Krafträder oder offene drei- oder mehrrädrige Kraftfahrzeuge mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von über 20 km/h führt sowie auf oder in ihnen mitfährt.
Ein Sikh, der aus religiösen Gründen einen Turban trug, stellte bei der Beklagten (Straßenverkehrsbehörde) einen Antrag auf Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zur Befreiung von der Pflicht, beim Motorradfahren einen Schutzhelm zu tragen (vgl. § 46 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 b Alt. 2 StVO). Der Antrag wurde mit der Begründung abgelehnt, eine Ausnahmesituation liege nur dann vor, wenn sich die Hinderung, einen Motorradhelm zu tragen, auf gesundheitliche Gründe stützt.
Der Widerspruch und die Verpflichtungsklage des Klägers vor dem Verwaltungsgericht Freiburg blieben erfolglos. Daraufhin legte der Kläger Berufung beim Verwaltungsgerichtshof Mannheim ein, der die Behörde dazu verpflichtete, erneut über den Antrag zu entscheiden und hierbei zu berücksichtigten, dass eine Ausnahmegenehmigung auch aus religiösen Gründen erteilt werden kann. Die Motorradhelmpflicht führt zwar nicht dazu, dass eine Person an der Praktizierung ihres Glaubens gehindert wird. Sie ist aber, sofern sie die Befolgung der religiösen Bekleidungsvorschriften als für sich verbindlich ansieht, gewissermaßen dazu gezwungen, auf das Motorradfahren zu verzichten. Aus diesem Grund kann eine mittelbare Beeinträchtigung der Religionsausübung vorliegen.
Der Kläger legte dann Revision gegen das Urteil des VGH beim Bundesverwaltungsgericht ein, welches diese zurückwies. Das BVerwG machte deutlich, dass das Vorliegen eines Hinderungsgrundes bzgl. des Helmtragens nicht dazu führt, dass eine unmittelbare Pflicht der Behörde zur Erteilung einer Ausnahmegenehmigung besteht. Eine solche ist nur dann möglich, wenn dem Betroffenen der Verzicht auf das Motorradfahren aus besonderen individuellen Gründen nicht zugemutet werden kann. Im konkreten Fall fehlte es an einer ausreichenden Darlegung solcher Gründe.
Darüber hinaus machte das BVerwG deutlich, dass die Religionsfreiheit aus Art. 4 Abs. 1 GG eingeschränkt werden kann, wenn diese Einschränkung gerechtfertigt ist. Hier standen der Beeinträchtigung der Religionsfreiheit des Klägers die Grundrechte Dritter aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG auf Leben sowie körperliche und psychische Unversehrtheit entgegen. Schließlich verfolgt § 21a Abs. 2 Satz 1 StVO als Ziel nicht nur den Schutz des Motorradfahrers und seiner Mitfahrer vor schweren (Kopf-)Verletzungen, sondern auch anderer Unfallbeteiligter (Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom 04.07.2019, BVerwG 3 C 24.17).
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Im konkreten Fall hatten der angeklagte Jugendliche und der Zeuge ihre Fahrzeuge auf der Landstraße mehrmals stark beschleunigt (Geschwindigkeiten von zumindest 149 km/h). Das Verhalten der beiden war ferner von einem deutlichen Unterschreiten des Sicherheitsabstands, Überholvorgängen mit überhöhtem Tempo trotz Überholverbots sowie starkem Abbremsen geprägt.
Das Amtsgericht Aurich verurteilte den Angeklagten wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen nach § 315 d StGB, verwarnte ihn und legte ihm auf, 800,- € an eine gemeinnützige Einrichtung zu zahlen. Ferner hatte die Strafbarkeit einen Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge.
Die vom Angeklagten eingelegte Berufung beim Landgericht Aurich hatte zumindest im Hinblick auf die festgestellte Strafbarkeit nach § 315 d StGB keinen Erfolg. Lediglich der Fahrerlaubnisentzug wurde durch ein Fahrverbot ersetzt. So wurde ihm zumindest das aufwendige Fahrerlaubnis-Neuantragsverfahren „erspart“.
Gem. § 315 d Abs. 1 Nr. 3 StGB wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft, wer sich im Straßenverkehr als Kraftfahrzeugführer mit nicht angepasster Geschwindigkeit und grob verkehrswidrig und rücksichtslos fortbewegt, um eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erreichen.
Im vorliegenden Fall hatten der Angeklagte und der Zeuge sich mit sehr hoher und damit nicht angepasster Geschwindigkeit auf der Landstraße fortbewegt, in der Absicht, eine höchstmögliche Geschwindigkeit zu erzielen. Durch die durchgeführten Überholvorgänge beider Fahrzeugführer mit möglichst hoher Geschwindigkeit (zeitweise 149 km/h) und geringem Sicherheitsabstand, bzw. durch die allgemein riskanten Fahrmanöver war das Verhalten der beiden wettkampf- und damit rennähnlich.
Das Landgericht stufte das Verhalten als grob verkehrswidriges Fahrverhalten ein, was angesichts der regennassen Fahrbahn auch die Rücksichtslosigkeit gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern zum Ausdruck brächte (LG Aurich, Urteil vom 15.11.2018).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Johlige, Skana & Partner Kurfürstendamm 173, 10 707 Berlin – Adenauerplatz 030 – 886 81 505
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Im konkreten Fall hatte der betroffene Fahrzeugführer eines Audi R8 vor einer auf Rot geschalteten Ampel gehalten. Neben ihm stand ein Kraftfahrzeug des Typs Lotus Sport 135R. Als die Ampel auf Grün schaltete, beschleunigten beide Fahrzeugführer mit hoher Drehzahl und quietschenden Reifen. Dieses Verhalten wiederholte sich an mehreren Ampeln hintereinander.
Das Amtsgericht Hamburg – St. Georg verurteilte den Betroffenen wegen vorsätzlicher Teilnahme an einem nicht genehmigten Kraftfahrzeugrennen zu einer Geldbuße in Höhe von 800,- Euro sowie zu einem zweimonatigen Fahrverbot gem. den später zum 13. Oktober 2017 außer Kraft getretenen, aber im Tatzeitpunkt noch geltenden §§ 29 Abs. 1, 49 Abs. 2 Nr. 5 StVO.
Der Betroffene legte gegen das Urteil Rechtsbeschwerde beim Oberlandesgericht Hamburg ein. Die Rechtsbeschwerde hatte Erfolg. Das Urteil des Amtsgerichts wurde aufgehoben.
Gem. dem nunmehr geltenden § 29 Abs. 2 Satz 1 StVO bedürfen Veranstaltungen, für die Straßen mehr als verkehrsüblich in Anspruch genommen werden, insbesondere Kraftfahrzeugrennen, der Erlaubnis. Fehlt diese Erlaubnis, spricht man von einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Definiert wird dieses als „ein Wettkampf von mindestens zwei Verkehrsteilnehmern – wenigstens auch – um die höchste Geschwindigkeit [zu erzielen]“, wobei auch Leistungsprüfungsfahrten zu Kraftfahrzeugrennen zählen, „wenn es den beteiligten Kraftfahrzeugführern nicht um die Ermittlung eines Siegers, sondern auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten ankommt“. Darüber hinaus muss es den Beteiligten nicht um die Erreichung von „absoluten“ Höchstgeschwindigkeiten gehen. Ein Vergleich des Beschleunigungspotentials der jeweiligen Fahrzeuge ist ausreichend.
Im konkreten Fall war es zwar nicht gänzlich abwegig, dass das Verhalten der beiden Fahrzeugführer auf die Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und eine damit verbundene Siegerermittlung oder jedenfalls auf einen Vergleich des Beschleunigungspotentials beider Fahrzeuge gerichtet war.
Dem Oberlandesgericht Hamburg fehlte es hierfür aber im Rahmen der Urteilsgründe des Amtsgerichts an überzeugenden Hinweisen und Argumenten. Ein dahingehender Wille der Beteiligten sei nicht mit der nötigen Klarheit zu verzeichnen. Vielmehr könne es sich nach dem Vorstellungsbild der Betroffenen auch um eine bloße „Schaufahrt ohne kompetitiven Hintergrund gehandelt haben, bei der es den Beteiligten darauf ankam, durch ihre Fahrweise Aufmerksamkeit zu erheischen, um ihre Fahrzeuge optisch und akustisch voreinander oder anderen Verkehrsteilnehmern in Szene zu setzen.“
Das Oberlandesgericht wendete insbesondere ein, dass von dem äußeren Ablauf des Geschehens nicht automatisch auf eine solche Willensrichtung der Beteiligten geschlossenen werden könne. Der Mangel an festgestellten Tatsachen wie z.B. einem Überholmanöver, scharfen Bremsen vor den roten Ampeln oder einem Spurwechsel erschwere die Annahme eines Rennens i.o.g. Sinne.
Weiterhin ergab sich für das Oberlandesgericht aus den Urteilsgründen des Amtsgerichts nicht, woran dieses eine Kontaktaufnahme und Verabredung eines Kraftfahrzeugrennens des betroffenen Fahrzeugführers mit seinem direkten „Nachbarn“ festmachte.
Der Beschluss des Oberlandesgerichts Hamburg spielt freilich nicht nur im Rahmen des neu gefassten § 29 Abs. 2 StVO eine Rolle, sondern auch bei § 315d StGB (OLG Hamburg, Beschluss vom 05.07.2019, 2 RB 9/19 – 3 Ss-OWi 91/18).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Johlige, Skana & Partner Kurfürstendamm 173, 10 707 Berlin – Adenauerplatz 030 – 886 81 505
Der betroffene Fahrzeugführer hatte aufgrund fahrlässiger Außerachtlassung der im Straßenverkehr erforderlichen Sorgfalt einen Unfall beim Umparken seines Fahrzeugs auf einem Garagenhof verursacht, indem er beim Drehen seines Fahrzeugs ein anderes Fahrzeug beschädigte. Der daraufhin herbeigerufenen Polizei beantwortete der Betroffene die Frage nach einem möglichen Drogenkonsum dahingehend, dass er am Vorabend des Tattages einen „Joint“ mit Cannabis geraucht habe, was sowohl durch Schnelltests als auch eine Blutprobeentnahme bestätigt werden konnte.
Nach § 24a Absatz 2 Satz 1 StVG handelt ordnungswidrig, wer zumindest fahrlässig (vgl. § 24a III StVG) unter der Wirkung eines in der Anlage zu dieser Vorschrift genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt. Das bedeutet, dass das berauschende Mittel zum Zeitpunkt des Führens eines Kraftfahrzeugs im Straßenverkehr „gewirkt“ haben muss. Eine solche Wirkung liegt gem. § 24a Absatz 2 Satz 2 StVG vor, wenn eine in dieser Anlage genannte Substanz im Blut zu diesem Zeitpunkt nachgewiesen wird. Nach § 24a Absatz 2 Satz 3 StVG gilt der Satz 1 jedoch nicht, wenn die Substanz aus der bestimmungsgemäßen Einnahme eines für einen konkreten Krankheitsfall verschriebenen Arzneimittels herrührt.
Der Beschluss des Oberlandesgerichts Bamberg hat noch einmal bestätigt, dass eine Drogenfahrt i.S.d. § 24a Absatz 2 StVG in der Regel dann anzunehmen ist, „wenn mit der im Blut des Betroffenen festgestellten Wirkstoffkonzentration der für die jeweilige Substanz in der Rechtsprechung allgemein anerkannte analytische Nachweisgrenzwert (für THC von 1 ng/ml) erreicht wird.“
Im konkreten Fall ergab die Blutprobeentnahme eine THC-Konzentration des Betroffenen von 0,9 ng/ml. Die Nachweisgrenze von 1 ng/ml war demnach noch nicht erreicht.
Es ist von den Oberlandesgerichten allerdings anerkannt, dass wegen einer Drogenfahrt gem. § 24a II, III StVG auch dann geahndet werden kann, wenn der analytische Nachweisgrenzwert noch nicht erreicht wurde. Dies setzt aber voraus, dass „neben der konkreten, den Nachweisgrenzwert nicht erreichenden Konzentration des berauschenden Mittels im Blut des Betroffenen weitere Umstände, namentlich drogenbedingte Verhaltensauffälligkeiten oder rauschmitteltypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden, die es als möglich erscheinen lassen, d.h. die den Schluss zulassen, dass der untersuchte Kraftfahrzeugführer am Straßenverkehr teilgenommen hat, obwohl seine Fahrtüchtigkeit durch die Wirkung des berauschenden Mittels eingeschränkt war.“
Das Amtsgericht Dortmund hat diese Rechtsauffassung übernommen und im vorliegenden Fall geprüft, ob drogentypische Verhaltensauffälligkeiten oder Ausfallerscheinungen des betroffenen Fahrzeugführers festzustellen waren, die trotz Unterschreiten der Nachweisgrenze eine Verurteilung wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Cannabiseinfluss nach § 24a II, III StVG rechtfertigen würden. Dies konnte jedoch nicht bestätigt werden (AG Dortmund, Urteil vom 02.04.2019, 729 OWi-254 Js 281/19-63/19 i.V.m. OLG Bamberg, Beschluss vom 11.12.2018, 3 Ss OWi 1526/18).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.Johlige, Skana & Partner Kurfürstendamm 173, 10 707 Berlin – Adenauerplatz 030 – 886 81 505