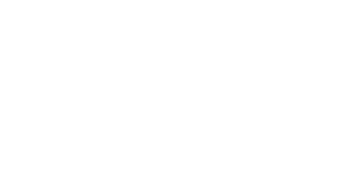Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Im Juni 2018 musste sich der 1. Strafsenat des Oberlandesgerichts Oldenburg mit einem etwas „exotischerem“ Thema im Bereich des Strafprozessrechts auseinandersetzen. Hier wurde die Justiz erfragt, ob eine Auslieferung eines Strafgefangenen nach Polen zulässig ist, oder ob sein verlängerter Aufenhalt in Deutschland eine Abschiebung entbehrlich mache.
Hier wurden folgende Erwägungen getroffen.
[1] Der größte Wertungspunkt in solchen Fällen stellt das Ziel des Strafvollzuges dar, die Resozialisierung. Hier wurde entschieden, dass eine Abschiebung in das Heimatland, auch wenn das von dem Strafgefangenen begehrt wird, nicht immer möglich ist. Es soll in dem Land vollstreckt werden, in welchem die Resozialisierungschancen merklich erhöht werden, dieser also eine verbesserte Lebensgrundlage nach seinem Vollzug wiederfährt.
Es gilt, die Resozialisierungschancen nun abzugrenzen.
Die Richter werteten dies beispielsweise in dem Maße seiner beruflichen, wirtschaftlichen und familiären sowie sozialen Bindungen im Inland, welche dieser sich über den jahrelangen Aufenthalt aufgebaut hat.
Des Weiteren wurde vom Gericht behauptet, dass ein ununterbrochener Aufenthalt von fünf Jahren im Inland eine ausreichende Integration und somit ein „Resozialisierungsfundament“ indiziert. Ein weiteres Kriterium stellt auch die Beherrschung der deutschen Sprache dar.
[2] Die Richter urteilten mit dem Grundsatz, dass im Falle einer Vollstreckung der Strafe im Herkunftsstaat grundsätzlich keine der Resozialisierung entgegenstehenden sprachlichen sowie kulturellen Probleme entgegenstehen, da die Person dort aufgewachsen ist. Deshalb muss, um ein Bewilligungshindernis nach § 83b IRG zu begründen, die Bindung an das derzeitige Inland (in unserem Fall: Deutschland) von besonderer Ausprägung sein. Beispielhaft lässt sich hier wieder die Eingliederung durch soziale Kontakte, die erlernte Sprache oder ein gefestigter Arbeitsplatz nennen.
[3] Letztendlich muss, um solch eine „Abschiebung“ zu verhindern, nach § 83 III IRG das Urteil dem Verurteilten zugestellt werden. In dem Fall, in dem noch keine sofortige Inhaftierung angeordnet wird, ist in solchen Fällen eine persönliche Zustellung des Urteils unabdingbar. Eine Niederlegung beim Postamt erfüllt eine solche Voraussetzung nicht.
Die Richter begründeten dies mit der Garantie und dem Aufrechterhalt einer dargeboteten Verteidigung, welche in solchen Fällen unerlässlich ist und die Grundrechte des Menschen aufgrund des Mehrnationenbezugs intensiver tangiert.
OLG Oldenburg, Beschluss vom 12.06.2018 – 1 Ausl 13/18
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
In diesem Beschluss, welcher vom Strafsenat am 29.11.2016 in der Sache „2 StR 472/16“ erlassen wurde, mussten die Richter über eine Revision des Landgerichts Aachen entscheiden.
Dem Beschluss liegt die Verhängung einer 3-jährigen Freiheitsstrafe aufgrund eines versuchten besonders schweren Raubes dreier Männer zugrunde.
Die Revision soll sachlich-rechtliche Fehler hinsichtlich der Beweiswürdigung aufdecken, welche sich aus Denkgesetzen und allgemeinen Erfahrungssätzen herleiten lassen.Hinsichtlich dieses Falles wurden durch den Beschluss weitere Grundsätze des Verfahrensrechts „ausgeleuchtet“ und erweiternd konkretisiert.
Fraglich war in diesem Fall, welcher tatnachweislichen Würdigung eine Wiedererkennung des Angeklagten durch eine geladene Zeugin zugesprochen werden kann.
Dabei wurden folgende Grundsätze durch die Richter des Bundesgerichtshofes konkretisiert.
[1] Wenn es zu einer Wiedererkennung durch einen Zeugen kommt, so muss durch den Richter die Bekundung des Zeugen wiedergegeben werden, auf denen dessen Wertung zur Wiedererkennung beruht. Konkret bedeutet dies, der Richter müsse wenigstens die erscheinungsbildliche Täterbeschreibung des Zeugen schemenhaft wiedergeben, das Wiedererkennen in der Hauptverhandlung hervorheben und objektive Übereinstimmungen bestätigen.
[2] Es sind Ausführungen durch den Richter zu erwarten welches das Wiedererkennen weiter konkretisiert. Hier ist auch zu unterscheiden, ob die Wiedererkennung durch den Zeugen erstmals aufgrund einer Einzellichtbildvorlage (dem Zeugen wird nur ein Personenbild vorgelegt und dieser misst daran seine Wiedererkennung) oder durch eine Wahllichtbildvorlage (dem Zeugen werden mehrere Personenbilder vorgelegt und dieser erkennt den Täter auf einem der Bilder wieder) erfolgt. Die Erkennung bei Einzellichtbildvorlage wird ein deutlich geringerer Beweiswert zugewiesen.
[3] Eine Wiedererkennung durch einen Zeugen in der Hauptverhandlung muss mit einer etwaigen verstärkten Suggestibiliät abgewogen werden. Dies bezeichnet das Phänomen, dass Menschen, welche in außergewöhnliche Ereignisse verwickelt waren, möglicherweise keinen beweiswürdigen fundamentierten Bezug zur Tat herstellen können und „das Gesehene“ mit „dem Eingebildeten“ vermischen. Im vorliegenden Fall wurde diskutiert, ob die Zeugin, nachdem sie von der Polizei veröffentlichte Fahndungsfotos kurz nach der Tat in einer Zeitung vernommen hat, die originäre Erinnerung durch die veröffentlichten Fotos eventuell „überschrieben“ wurde und sie nun Bezug zu ihren Tätern herstellt, obwohl kaum Gemeinsamkeiten objektiv feststellbar waren.
[4] Letztendlich muss der Richter schließlich die konkrete Wahrnehmungssituation mit den Aussagen der Zeugin sowie deren Wiedererkennung vergleichen und miteinander abwägen, ob eine Wiedererkennung in der konkreten Situation der Zeugin aus subjektiver Sicht zum Tatzeitpunkt überhaupt möglich war. Er solle hier eine Kontrollinstanz für eine verlässliche Identifizierung darstellen.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 29.11.2016 – 2 StR 472/16
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Der bayerische Verwaltungsgerichtshof musste sich im August 2018 unter dem Aktenzeichen „11 CS 18.1270“ mit verschiedenen Anforderungen eines medizinisch-psychologischen Gutachtens auseinandersetzen.
Dem Fall ist folgender Sachverhalt zugrunde zu legen:
Dem Beschuldigten werden zwei Verkehrsordnungswidrigkeiten mit erhöhter Blutalkoholkonzentration zugrunde gelegt. Das zuständige Landratsamt fordert den Beschuldigten auf, ein medizinisch-psychologisches Gutachten vorzulegen, um den Beweis zu erbringen, dass er zum Führen von KFZs geeignet ist.
Bezüglich des Gutachtens wurden vom BayVGH verschiedene Anforderungen herausgearbeitet:
- Ein Gutachten ist nicht als „schlüssig und nachvollziehbar“ anzusehen, wenn dessen Feststellungen nicht in Einklang miteinander stehen.
In diesem Fall kritisierten die Richter die Ausführung des Gutachtens, in welchem einerseits eine ausreichende und situationsangemessene Kooperation des Gutachtenerbringers positiv hervorgehoben, andererseits aber bemängelt wurde, dass das Gesprächsverhalten für den Erhalt von Hintergrundinformationen nicht ausreichend gewesen sei.
- Bei einem Fahrerlaubnisentzug ist es Sache der Faherlaubnisbehörde, die Tatsachen zu ermitteln, welche den Zweifel an der Fahreignung rechtfertigen. Die Verpflichtung des Betroffenenen gilt nur für die Mitwirkung zur Aufklärung schon bekannter Tatsachen. Eine Behilfspflicht zur Begründung unbekannter Tatsachen kann aus diesem Grundsatz nicht abgeleitet werden. Kommt die Behörde zu keinem eindeutigen Entschluss der Fahruntauglichkeit, so ist eine Fahrerlaubnisentziehung nicht anzuordnen.
- Die Behörde berief sich weiterhin darauf, dass ein nicht fristgerecht vorgelegtes Gutachten die Ungeeignetheit des Betroffenen indiziere. Dies dementierten die Richter des Verwaltungsgerichts jedoch und wiesen darauf hin, dass eine nicht fristgerechte Einbringung der Auflage lediglich ein Indiz für die Ungeeignetheit des Betroffenen darstellt, jedoch keine sofortige Begründung. Die Frist zur Einbringung stellt in dieser Hinsicht keine Ausschlussfrist dar.
- Letztendlich argumentierte der Betroffene die Verzögerung der Einbringung mit Grund, dass er die Nachbesserung des unzulänglichen, ersten Gutachtens verlange. Dies müsste als „hinreichender Grund“ für die Nichteinbringung vorliegen. Die Richter folgten dieser Auffassung und erkannten die Nachbesserungsforderung als „hinreichenden Grund“ an. Ob die Nachbesserung im Nachhinein erfolgreich ist, ist nicht von Belang.
– Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Beschluss vom 07.08.2018; AZ.: 11 Cs 18.1270
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass das oben geschilderte Urteil nicht verallgemeinerungsfähig ist. Vielmehr bedarf es einer genauen Prüfung des Einzelfalls, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Der Autor Sven Skana ist Fachanwalt für Verkehrsrecht, Spezialist für Verkehrs-Unfallrecht sowie Spezialist für Führerscheinangelegenheiten im Betäubungsmittelrecht. Er ist Partner in der Kanzlei Johlige, Skana & Partner in Berlin, Kurfürstendamm 173-174, 10 707 Berlin, Tel: 030/886 81 505.
Das Amtsgericht Offenburg hatte am 05.04.2018 über zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen in Verbindung mit einem Fahrverbot bei fehlender Tatmehrheit zu entscheiden.
Die Richter urteilten, dass auch wenn zwei Verstöße in zeitlich und örtlich engem Zusammenhang stehen, jedoch aufgrund unterschiedlicher Zuständigkeiten nicht gemeinsam verhandelt werden, nur die Anordnung eines Fahrverbots in Betracht komme.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Betroffenen wurde für ein Vergehen am 24.08.2017 ein Bußgeldbescheid zur Last gelegt, welcher die Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h außerorts mit 160 € Bußgeld sowie einem Fahrverbot von einem Monat sanktionierte.
Kurz zuvor, am 17.08.2017, missachtete die Fahrzeugführerin auf der gleichen Fahrbahn ein vorheriges Straßenverkehrsschild und überschritt die Höchstgeschwindigkeit außerorts um 45 km/h. Da der Betroffenen die Fahrbahn und deren Geschwindigkeitsregelungen ortsbekannt waren, wurde in diesem Fall sogar Vorsatz angenommen.
Die Besonderheit des Falles zeigt sich jedoch dahingehend, dass die zwei Ordnungswidrigkeiten zwar in einem engen zeitlichen und örtlichen Rahmen geschahen, jedoch unterschiedlichen Zuständigkeiten unterliegen. (AG Kehl und AG Offenburg).
Im Regelfall kommt es in beiden Fällen zu einer Anordnung eines Fahrverbots zu je einem Monat. Der BGH hat jedoch in seinem Beschluss vom 16.12.2015 (AZ.: 4 StR 227/15) klargestellt, dass bei zwei in Tatmehrheit geschehenen Ordnungswidrigkeiten, welche gleichzeitig entschieden werden, lediglich ein einheitliches Fahrverbot zu verhängen sei. Eine Abweichung stellt hier lediglich ein größerer zeitlicher Abstand sowie eine einheitliche Zuständigkeit zum hiesigen Fall dar.
Aufgrund der Parallelen zur BGH-Entscheidung 4 StR 227/15 urteilte das AG Offenburg sinnesgleich und verhängte lediglich ein einmonatiges Fahrverbot. Dies soll in diesen Fällen als „Denkzettel – und Besinnungsmaßnahme“ spezialpräventiv wirken.
Im oben genannten Fall ist dies durch die zeitlichen und örtlichen Zusammenhänge in Anbetracht der Verhältnismäßigkeit der Sanktion gegeben. Die Besonderheit, dass die Verfahren unterschiedlichen Zuständigkeiten unterliegen und es dadurch zu einer differenzierten Rechtsanwendung kommen soll, würde dem Rechtsgedanken und der damit verbundenen Verhältnismäßigkeit keine geeignete Anerkennung zukommen lassen.
AG Offenburg, Beschluss vom 05.04.2018 – 3 OWi 207 Js 20872/17
Hinweis
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Gem. § 24a Abs. 2 S. 1 StVG handelt ordnungswidrig, wer unter der Wirkung eines im Gesetz genannten berauschenden Mittels im Straßenverkehr ein Kraftfahrzeug führt.
Eine solche Wirkung liegt nach § 24a Abs. 2 S. 2 StVG vor, wenn eine entsprechende Substanz im Blut nachgewiesen wird. Dabei begeht eine Ordnungswidrigkeit nicht nur derjenige, der vorsätzlich handelt, sondern auch, wer die Tat fahrlässig begeht (§ 24a Abs. 3 StVG), d.h. die im Verkehr erforderliche Sorgfaltspflicht verletzt.
In diesem Zusammenhang stellt sich oft die Frage, ab welchem Zeitpunkt von einer Fahrlässigkeit ausgegangen werden kann. Der 3. Senat für Bußgeldsachen des Kammergerichts hat in seinem Beschluss vom 28.02.2018 (AZ: 3 Ws (B) 48/18) festgehalten, dass bereits derjenige fahrlässig handelt, der „nach dem Konsum berauschender Mittel ein Kraftfahrzeug führt, ohne sich sicher sein zu können, dass der Rauschmittelwirkstoff vollständig unter den analytischen Grenzwert abgebaut ist.“ Ist der Konsument sich nicht sicher, ob der Wirkstoff abgebaut ist, dürfe er kein Kraftfahrzeug führen.
In Zahlen bedeutet dies konkret, dass eine (subjektive) Sorgfaltspflichtverletzung und damit Fahrlässigkeit unzweifelhaft gegeben ist, „wenn der analytische Grenzwert von 1,0 ng/ml Tetrahydrocannabinol (THC) im Blutserum bei der Fahrt erreicht wird.“
Damit findet die frühere sog. „Längere-Zeit-Rechtsprechung“ KEINE Anwendung mehr. Nach der alten Rechtsprechung konnte dem Konsument von Rauschmitteln, dessen Konsum „längere Zeit“ (14-18 Stunden) zurücklag, ein Fahrlässigkeitsvorwurf nur gemacht werden, wenn zusätzlich besondere Umstände vorlagen.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Rechtstipp vom 9.11.2018
Mit Urteil vom 31.01.2017 entschied das OLG Hamm, dass der Tatbestand des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr auch durch einen Beifahrer erfüllt werden kann, der die Beifahrertür öffnet, um einen anfahrenden Radfahrer absichtlich zu Fall zu bringen oder ihn zumindest zu einem riskanten Ausweichmanöver zu zwingen.
Der Angeklagte war Beifahrer im Pkw des Mitangeklagten. Dieser war im Begriff, mit seinem Fahrzeug rechts in eine Seitenstraße abzubiegen, als er von dem Kläger mit dessen Fahrrad von rechts überholt wurde. Der Kläger bog ebenfalls und sehr knapp vor dem Pkw in die Straße rechts ab, weshalb der Mitangeklagte stark abbremsen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.
Aufgrund dessen entschlossen sich beide Fahrzeuginsassen dazu, den Radfahrer zur Rede zu stellen und ihn dafür zum Anhalten und Absteigen zu zwingen. Der Mitangeklagte beschleunigte sein Fahrzeug, überholte den Kläger hupend und lenkte nach rechts ein, um ihm so den Weg abzuschneiden. Um ihn hierbei zu unterstützen, öffnete der Beklagte leicht die Beifahrertür. Dem Kläger war so die Weiterfahrt nicht möglich. Er musste ausweichen und notbremsen. Dabei stürzte er vom Rad und prallte gegen ein am Straßenrand parkendes Auto. Er zog sich hierdurch diverse Prellungen zu. An seinem Rad entstand ein Sachschaden i. H. v. 260 €, an dem geparkten Pkw ein Schaden i. H. v. 330 €.
Beide Angeklagte registrierten den Sturz. Der Mitangeklagte bremste zwar kurz ab, beschleunigte dann aber erneut, ohne dass sich beide Angeklagte um den verletzten Kläger kümmerten.
Das AG Paderborn verurteilte den Angeklagten und Mitangeklagten jeweils wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gemäß § 315b Abs. 1 Nr. 2 StGB in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung gemäß § 224 Abs. 1 StGB zu einer zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe von acht Monaten. Das Urteil wurde durch den Richter am Landgericht nach eingelegter Berufung seitens des Angeklagten jedoch bestätigt.
Auch die Revision vor dem OLG Hamm ist erfolglos geblieben. Es führte auf, dass der Angeklagte sich als Mittäter nach § 25 II StGB strafbar gemacht hat. Es kommt insoweit nicht darauf an, dass er als Beifahrer das Fahrzeug nicht selbst gesteuert habe. Es könne jeder Täter i. S. v. § 315 b StGB sein, der das nach dem gesetzlichen Tatbestand zu sanktionierende Verhalten beherrsche. Es kommt insoweit nicht auf ein tatsächliches „Führen“ eines Fahrzeugs an, sondern darauf, dass dieses nicht mehr als Mittel zur Fortbewegung, sondern zur Verletzung oder Nötigung eingesetzt werde (sog. Pervertierung des Straßenverkehrs).
Indem der Angeklagte die Beifahrertür bewusst öffnete, während der Mitangeklagte das Fahrzeug schräg nach rechts lenkte, um den Radfahrer abzudrängen, wurde das Fahrzeug gerade zur Pervertierung eingesetzt. Durch diese Handlung haben beide Fahrzeuginsassen vorsätzlich ein Hindernis i. S. v. § 315b Abs. 1 Nr. 2 StGB bereitet und somit den Tatbestand erfüllt (Urteil des OLG Hamm vom 31.01.2017).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Rechtstipp vom 7.11.2018
Die 8. Große Strafkammer des LG Braunschweig hat im Juli 2016 per Beschluss einen neuen Richtwert (1500,- € oder mehr) bezüglich des bedeutenden Schadens im Sinne von § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB aufgestellt. Man wich insoweit nach 14 Jahren erstmalig wieder von der ständigen Rechtsprechung ab, welche bereits ab 1300,- € einen solchen bedeutenden Schaden als gegeben sah.
Im vorliegenden Fall hatte der Beschuldigte beim Abbiegevorgang die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit mehreren parkenden Fahrzeugen kollidiert, wobei ein Gesamtschaden von 1.387,54 € entstand. Aus Angst vor den drohenden Folgen ist er dann zunächst weitergefahren ohne eine nach den Umständen angemessene Zeit abzuwarten, ob ein Feststellungsinteressent erscheine. Zwar kam der Beschuldigte zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zurück. Jedoch musste er dann feststellen, dass die beschädigten Fahrzeuge sich nicht mehr an Ort und Stelle befanden.
Die Staatsanwaltschaft Braunschweig stellte dann im April 2016 den Antrag, dem Beschuldigten die Fahrerlaubnis umgehend vorläufig gem. § 111 a StPO zu entziehen, welchen das AG Braunschweig jedoch ablehnte. Gegen diesen Nichtabhilfebeschluss richtete sich sodann die Staatsanwaltschaft mit der Rechtsbeschwerde.
Diese hatte jedoch keinen Erfolg: So argumentierte die Staatsanwaltschaft, dass mit der ständigen Rechtsprechung davon auszugehen sei, dass hier bereits ab einem Schaden von 1300,- € eine Entziehung nach § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB erfolgen müsse und daher dringende Gründe im Sinne der vorläufigen Entziehung nach § 111a StPO gegeben seien.
Diese Ansicht wurde vom LG Braunschweig nicht geteilt. So könne bei der Interpretation ausfüllungsbedürftiger Tatbestandsmerkmale wie dem „bedeutenden Schaden“ im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB die allgemeine Geldentwicklung nicht außer Betracht bleiben. Es sei daher der seit dem Jahre 2002 unveränderte Wert nunmehr anzupassen.
Hierfür sei einziger belastbarer Anhaltspunkt für die durchschnittliche Preisentwicklung der Verbraucherpreisindex. Legt man diesen jedoch zu Grunde, ergibt sich seit dem Jahr 2002 eine Steigerung von 20,65 %, sodass der Verbraucherpreisindex nunmehr bei etwa 1.568,45 € liegt. Es sei daher angemessen, den Wert für einen bedeutenden Schaden im Sinne des § 69 Abs. 2 Nr. 3 StGB ab dem Jahr 2016 auf mindestens 1.500,00 € festzusetzen (Beschluss des LG Braunschweig Juni 2016).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Rechtstipp vom 5.11.2018
Das BVerfG hat im November 2017 per Beschluss entschieden, dass eine Wohnungsdurchsuchung, die auf vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen gestützt wird, das Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 GG auf Unverletzlichkeit der Wohnung verletzt.
Im vorliegenden Fall kam es in einem Schwimmbad zu einem vermeintlichen Diebstahl eines Mobiltelefons, wobei der Geschädigten der Beschwerdeführer aufgefallen sein wollte, weil dieser sie „regelrecht verfolgte“.
Als die Geschädigte – nach Bemerken des mutmaßlichen Abhandenkommens des Mobiltelefons – diesen sodann auf den vermeintlichen Diebstahl ansprach, erwiderte dieser, er müsse ihr seine Tasche nicht zeigen und verließ zügig den Bereich des Schwimmbades.
Aufgrund ihrer Vermutung, dass es sich um den Täter handeln müsse, stellte sie sodann Strafanzeige bei der Polizeiinspektion, woraufhin das AG Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft die Wohnungsdurchsuchung des Beschwerdeführers zwecks Auffindung von Beweismitteln – namentlich des Mobiltelefons IPhone 6 SE anhand der IMEI-Nummer – anordnete.
Zu einer Auffindung des besagten Mobiltelefons kam es durch den Vollzug der Wohnungsdurchsuchung jedoch nicht. Das Ermittlungsverfahren wurde letztlich gem. § 170 Abs. 2 StPO eingestellt.
Der Beschwerdeführer sah sich allerdings dennoch in seinem Grundrecht aus Art. 13 Abs. 1 GG verletzt und forderte anhand einer Beschwerde gegen die Anordnung der Wohnungsdurchsuchung zu einer Stellungnahme auf, warum ein Durchsuchungsbeschluss trotz lediglich vagen Anhaltspunkten und bloßen Vermutungen erwirkt wurde.
Der Beschwerde gegen die Wohnungsdurchsuchung half das Amtsgericht indes nicht ab, sodass der Beschwerdeführer schließlich erfolgreich Verfassungsbeschwerde beim BVerfG erhob.
Das BVerfG führte insoweit aus, dass mit der Garantie der Unverletzlichkeit der Wohnung durch gem. Art. 13 Abs. 1 GG die räumliche Lebenssphäre des Einzelnen einen besonderen grundrechtlichen Schutz erfährt, in den mit einer Durchsuchung schwerwiegend eingegriffen wird.
Insoweit bedürfe es zur Rechtfertigung eines solchen Eingriffes zum Zwecke der Strafverfolgung eines Verdachts, dass eine Straftat begangen wurde, wobei jener auf konkreten Tatsachen beruhen müsse.
Nicht ausreichend seien demnach vage Anhaltspunkte und bloße Vermutungen. Zu berücksichtigen sei ferner, dass stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten sei, also die Durchsuchung in einem angemessenen Verhältnis zur Schwere der Tat und der Stärke des Tatverdachts stehen müsse.
All dies sei bei der Anordnung der Wohnungsdurchsuchung nicht beachtet worden, sodass die angefochtenen Entscheidungen insgesamt rechtswidrig seien, so das BVerfG (Beschluss des BVerfG November 2017).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Rechtstipp vom 6.11.2018
Der BGH hat mit Beschluss vom 30. August 2017 entschieden, dass Schüsse auf Fahrzeuge im Straßenverkehr nicht immer einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr i.S.d. § 315 b Abs.1 StGB darstellen.
Hintergrund dieses Beschlusses war, dass ein Fahrer einen Pistolenschuss auf ein neben ihm befindliches Fahrzeug abgegeben hat.
Der BGH verlangt, dass eine konkrete Gefahr für eines der in § 315 b Abs. 1 StGB genannten Schutzobjekte vorliegen muss, die auf die Wirkungsweise der für die Verkehrsvorgänge typischen Fortbewegungskräfte, beispielsweise die Dynamik des Straßenverkehrs, zurückzuführen ist.
Daran würde es fehlen, wenn der Schaden lediglich auf der Dynamik der auftretenden Projektile beruht, die durch die Pistolenschüsse selbst freigesetzt wird. Laut BGH müsse der Täter in seine Vorstellung aufnehmen und billigen, dass es infolge des Schusses zu einem Beinahe-Unfall kommen kann.
Nur in einem solchen Fall kann der Täter dann wegen Versuchs des §315 b Abs. 1 StGB verurteilt werden.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.