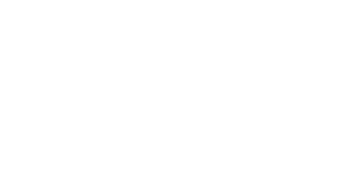Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Der Bundesgerichtshof musste sich Ende 2018 nochmals mit der Auslegung der Verkehrsstrafdelikte befassen, genauer gesagt dem § 315 b StGB. Die Richter beschlossen, dass die Schaffung eines Hindernisses mittels eines Fahrrades auf dem Fahrstreifen noch keinen gefährlichen Eingriff im Sinne des § 315 b Abs. 1 Nr. 2 StGB darstelle.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
In einer Nacht im Januar 2018 sah sich eine LKW-Fahrerin auf einer vollkommen unbeleuchteten Straße am Waldrand gezwungen eine Vollbremsung einzuleiten, da inmitten des Fahrstreifens ein Fahrrad abgelegt wurde. Trotz der Vollbremsung und dem Versuch, den LKW zum Stehen zu bringen, stieß er gegen das Fahrrad. Dahinter verbarg sich ein erschreckender Tatplan eines Mannes, welcher das Rad absichtlich auf der Straße abgelegt hat, um Fahrzeugführer zur Vollbremsung zu veranlassen, um diese dann mit einer Axt ihres Fahrzeuges zu berauben. Das Landgericht Kleve, welches in erster Instanz sachlich sowie örtlich zuständig war, verurteilte den Mann wegen vorsätzlichen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, § 315 b Abs. 1 Nr. 2 StGB.
Gegen die Entscheidung legte der Angeklagte Revision zum Bundesgerichtshof ein. Diese hoben die Entscheidung des Landgerichts zugunsten des Angeklagten auf, denn aus ihrer Sicht sei eine Strafbarkeit des gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr nicht zu erkennen. Dies folgte aus der Analyse der Feststellungen des erstinstanzlichen Landgerichts, welche keine konkrete Gefahr für Leib oder Leben eines anderen Menschen oder fremde Sachen von bedeutendem Wert durch den Eingriff mit dem Fahrrad erkennen konnten. Das Merkmal der Gefährdung ist kausal an den Eingriff gekoppelt und müsse sich demnach aus diesem ergeben.
Bezüglich des Umstandes, dass es sich hier um einen LKW handelte, reicht die Berührung des Fahrzeuges mit dem Hindernis nicht aus, um in irgendeiner Art und Weise eine konkrete Gefahr für die Fahrzeugführerin noch für den LKW selbst zu konstruieren. Aufgrund mangelnder Feststellung über die gefahrene Geschwindigkeit vor der Vollbremsung oder der Möglichkeit einer Ausweichreaktion und anschließendes Abkommen von der Straße konnte das Merkmal der konkreten Gefahr in keiner nachgewiesenen Konstellation bejaht werden.
Auch die Annahme, dass ein bedeutender Sachschaden eingetreten ist oder hätte eintreten können, ist nach den Feststellungen des Landgerichtes nicht nachzuweisen. Dies hat lediglich den Fahrzeugwert feststellen lassen, jedoch keine weiteren Angaben zu dem erwartenden Schadensbild sowie dessen Bewertung durch ein Gutachten veranlasst. Der Bundesgerichtshof hob das Urteil des Landgerichts auf und verwies mit der Bitte zur erweiterten Feststellung zurück an die zuständige Strafkammer.
Fraglich ist, wie die Entscheidung bezüglich der konkreten Gefahr des gefährlichen Eingriffes zu entscheiden wäre, wenn es sich nicht um einen tonnenschweren LKW, sondern um einen kleinen PKW gehandelt hätte, welcher womöglich durch das Hindernis die Spur verloren oder erhebliche Schäden an der Karosserie davongetragen hätte. Hinsichtlich dieser Frage steht eine höchstrichterliche Entscheidung noch aus (Bundesgerichtshof, Beschluss vom 05.12.2018 – 4 StR 505/18).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Amtsgericht München musste sich im Januar 2018 mit kreativen Trickdiebstählen eines 58-jährigen Angeklagten beschäftigen, welcher innerhalb eines Monats viermal beim Umpacken von Lebensmitteln in einem Supermarkt erwischt wurde. Dies führte zu einer Geldbuße von 208.000 € (!).
Dem Urteil der Richterin lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Verurteilte hatte viermal binnen eines Monates versucht, in einem Supermarkt in München-Haidhausen Kalbsleber im Wert zwischen 13 und 47 € in eine Obsttüte zu verpacken und diese dann an der Selbstbedienungskasse als billigeres Obstprodukt abzuwiegen, um so einen deutlich günstigeren Preis an der Abwicklungskasse zu bezahlen. Dies hatte die Richterin des Amtsgerichtes auch richtigerweise als Diebstahl nach § 242 StGB ausgelegt und keinen Betrug nach § 263 StGB angenommen, da die Kassiererin des Supermarktes nur die von außen ersichtlichen Inhalte der Verpackung an den vermeintlichen Käufer übereignet. Da sich in diesem Fall jedoch Kalbsleber statt der angegebenen Obstsorten in der Tüte befand, wurde dies nicht mit Einverständnis der Kassiererin übertragen und demnach „weggenommen“.
Bei der vierten Tatbegehung wurde der Angeklagte vom Marktleiter nach dem Kassenbereich gestoppt und auf frischer Tat ertappt. Da dieser keinen festen Wohnsitz in Deutschland angeben konnte, wurde Untersuchungshaft angeordnet. In der Hauptverhandlung hatte der Mann ein vollständiges Geständnis abgelegt, welches auch mit den Zeugenaussagen der Vergehen übereinstimmte.
Bei der Urteilsfindung wurde die kriminelle Vergangenheit des Täters offengelegt. Dieser hat sich erstmals 2011 wegen Diebstahls einer Tonerkassette schuldig gemacht. 2013 wurde er aufgrund Steuerhinterziehung durch Verschweigen ausländischer Konten zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren und einer Geldstrafe von 440.000 € verurteilt. Im Jahr 2015 musste sich der Angeklagte nochmals aufgrund nachfolgender Steuerveranlagungsvergehen und der Vortäuschung eines ausländischen Wohnsitzes vor Gericht verantworten, welches ihn letztendlich zu knapp zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilte. Die vorangegangene Bewährung wurde widerrufen.
Aufgrund dieser Umstände sah sich die Richterin gezwungen, in diesem Fall eine stark erhöhte Geldstrafe von 208.000 € festzulegen, obwohl es sich lediglich um Diebesgut von ca. 100 € handelte. Ihm könne zwar zur Strafmilderung zugetragen werden, dass er ein umfangreiches Geständnis abgegeben und auch eine bestimmte Zeit in Untersuchungshaft verbüßt habe, jedoch wiegen die zahlreichen Eintragungen im Bundeszentralregister aufgrund Vermögensdelikten sowie der erst kurzfristigen Haftentlassung deutlich schwerer.
Obwohl die Gesamtsumme der Strafe auf den ersten Blick unverhältnismäßig klingt, so ist zu erwähnen, dass der Verurteilte in eigener Einlassung ein Monatseinkommen von ca. 24.000 € gegenüber dem Gericht angab.
Amtsgericht München, Urteil vom 10.01.2018 – 864 Ds 238 Js 223135/17 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Die Richter des Oberlandesgerichts Hamm mussten sich im Juli 2019 mit dem Begriff der „geringfügigen Ordnungswidrigkeit“ sowie dem Thema beschäftigen, ob vom Regelbußgeldsatz aufgrund überdurchschnittlicher wirtschaftlicher Verhältnisse des Beklagten abgewichen werden darf.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Das Amtsgericht hat den Betroffenen aufgrund fahrlässiger Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit zu einer Geldbuße von 210 EURO verurteilt und wich dabei zu 75 % „nach oben“ vom Regelbußgeldsatz 120 EURO ab, da vom Tatrichter geschätzt wurde, dass der Beklagte ein überdurchschnittliches Einkommen erzielt. Gegen diese Erhöhung der Regelgeldbuße richtet sich der Betroffene mit einer Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht.
Dies gab der zulässigen Rechtsbeschwerde jedoch aufgrund folgender Begründung nicht statt.
Einerseits ist es nach § 17 Abs. 3 Satz 2 OWiG möglich, in Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Feststellung besonders außergewöhnlichen und guten wirtschaftlichen Verhältnissen des Betroffenen die vorgeschlagene Regelbußgeldsumme zu erhöhen. Die im Bußgeldkatalog als Anlage befindlichen Bußgeldregelsätze sind im Einzelnen systematische Zumessungsrichtlinien, welche sich nach dem Durchschnittseinkommen eines Arbeitnehmers in Deutschland von 3.339 EURO brutto richten. Das Gericht hat das Ziel, die Einzelfallgerechtigkeit herzustellen. Dies könne nach Argumentation der Richter in beide Richtungen ausschlagen und somit einerseits zur Senkung der Regelgeldbuße führen, um sozial-schwache Täter nicht zu stark zu belasten, jedoch andererseits auch eine Erhöhung der Geldbuße rechtfertigen, um eine gleichmäßige Sanktionsgewichtung zu erlangen.
Der Betroffene führt jedoch das Argument, dass eine Abweichung vom Regelsatz vor allem bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten nach § 17 Abs. 3 Satz 2 2. Halbsatz OWiG nicht angewendet werden darf, eine solche jedoch hier vorliege. Die Richter nutzten die Chance zur Aufklärung und stellten klar, dass seit dem 01.05.2014 die Schwelle der Geringfügigkeit bei dem Regelsatz von 55 EURO endet. Alles was diesen Wert im Regelsatz übersteigt, ist nicht als geringfügig einzustufen und unterliegt demnach der richterlichen Korrekturmöglichkeit.
Da der Beklagte keine Angaben hinsichtlich seines Einkommens gegenüber den Behörden und Gerichten getätigt hatte und lediglich Kenntnis über seine Stellung als Geschäftsleiter einer Firma bestand, welche einen Jahresumsatz von ca. 25 Mio. EURO umfasst, musste sein Einkommen seitens des Tatrichters geschätzt werden. Diese Schätzung unterlag der Differenzierung gegenüber eines durchschnittlichen Arbeitnehmers. Die umfangreichen Informationen über die Firma des Beklagten reichten laut Ansicht der OLG-Richter aus, um eine hinreichende Schätzgrundlage anzunehmen, so dass dieser Methodik nichts entgegenstehe, solange sie keine offensichtlichen Fehler beinhaltet, was hier abzulehnen war.
Durch Abweisung der Rechtsbeschwerde machen die Richter des Oberlandesgerichtes klar, dass die Einzelfallgerechtigkeit auch durch die Erhöhung des Regelbußgeldsatzes bei außergewöhnlichen Umstand rechtmäßig sein kann.
Besitzen Sie ein überdurchschnittliches Einkommen und sind in ein Ordnungswidrigkeitsverfahren verwickelt, so ist es ratsam, die Vorgehensweise zuerst durch einen Fachanwalt prüfen zu lassen, um keine belastendere Verurteilung zu erhalten (OLG Hamm, Beschl. v. III 3 RBs 82/19).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Das Landgericht Bielefeld musste im Urteil vom Dezember 2019 darüber entscheiden, ob der Beschuldigte die Kosten für das eigens /selbst bezahlte außergerichtliche Sachverständigengutachten von der Staatskasse zurückverlangen kann. Dies ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, welche das Gericht in diesem Fall detailliert darstellte.
Zum Sachverhalt: Das Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde aufgrund eines eigens in-Auftrag-gegebenen außergerichtlichen Gutachtens durch den Beschuldigten eingestellt. Die Kosten des Verfahrens wurden der Staatskasse aufgetragen. Der Beschuldigte wandte sich nun an das Gericht, um auch die durch ihn aufgewendeten Kosten für das Sachverständigengutachten erstattet zu bekommen. Dies lehnte das Amtsgericht in erster Instanz ab und verweigerte einen Festsetzungsantrag. Aufgrund Rechtsbeschwerde wurde die Sache an das Landgericht verwiesen. Dies sprach dem Beklagten die Erstattung der Kosten zu, da es sich gemäß §§ 46 Abs. 1 OWiG, 464 a Abs. 2 StPO um „notwendige Auslagen“ handelte.
Zur Systematik der Auslagenerstattung:
Im Strafprozess ist der Beklagte weitestgehend zu schützen. Dies wird einerseits durch den vollkommenen und umfangreichen Schutz des Prinzips der allseitigen Aufklärung gewährleistet, andererseits ist dem Angeklagten das Recht eingeräumt, Beweisanträge zu stellen sowie sich auf den Zweifelgrundsatz „in dubio pro reo“ zu berufen. Aufgrund dieser eingebauten Schutzmechanismen ist es nach Gesetz lediglich in besonderen Ausnahmefällen möglich, eigene Auslagen für Ermittlungen und Beweiserhebungen erstattet zu bekommen. Nämlich nur in den Fällen, in welchen eine Notwendigkeit des Eingreifens durch den Beklagten bejaht werden kann, weil die bereits oben genannten Systeme versagen:
Z.B. ärztliches Gutachten zum Gesundheitszustand, Unfallrekonstruktionsgutachten, technische Überprüfungen von Geschwindigkeitsmeßgeräten, Alkohol- und Btm-Gutachten etc.
Diese Notwendigkeit wird beispielsweise dadurch indiziert, wenn der Prozess mit einer schwierigen technischen Fragestellung behaftet ist und diese durch einen sachverständigen Gutachter aufgeschlüsselt werden müssen oder eine Verschlechterung der Beweislage im Prozess aus ex-ante- Sicht zulasten des Betroffenen droht (ex-ante= zum aktuellen Zeitpunkt des Prozesses). In vereinzelten Urteilen (z.B. LG Dresden, Beschl. v. 07.10.2009 – 5 Qs 50/07) wird diese Notwendigkeit sogar dann bejaht, wenn im Nachhinein (ex-post) ersichtlich wird, dass ohne das Gutachten der Prozess eine „andere Richtung“ i.S.d. Urteilsfindung eingeschlagen hätte.
Das LG Bielefeld hat die Notwendigkeit aufgrund der ex-ante-Erheblichkeit des Gutachtens während des laufenden Prozesses bejaht. Dies wurde wie folgt begründet:
Einerseits wurde das Verfahren bezüglich einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit geführt, die zugrundeliegende Geschwindigkeitsmessung wurde mittels eines Lasermessgerätes absolviert. Dies stelle vor allem für Laien eine technisch-schwierige Fragestellung dar, welche eines Sachverständigengutachtens bedürfe.
Da es sich bei dem genutzten Messgerät (Traffistar S350) jedoch um ein vom sogenanntes „standartisiertes Messverfahren“ handelt (OLG Düsseldorf – Beschluss vom 09.05.2017, IV-3 RBs 56/17), müsse das Gericht die Messung nicht anzweifeln, solange keine konkreten Anhaltspunkte für Fehler ersichtlich sind. Dies schränkt das Prinzip der allseitigen Aufklärung zulasten des Betroffenen ein. Da dieser aufgrund mangelnden technischen Verständnisses keine Einwände über die Messung erbringen konnte und das Gericht deshalb selbst keine Nachforschungen anstellte, heuerte er einen Sachverständigen an, welcher ein Gutachten über die Messung anfertigte.
In diesem Gutachten wurde ersichtlich, dass sich auf dem Messgerät eine andere Softwareversion befand, welche von dem im schriftlichen Vorverfahren übermitteltem Begleitzertifikat über die Messung angegeben war. Somit erfüllte das Zertifikat nicht die Anforderungen, welche für eine rechtmäßige Messung erbracht werden müssen.
Ohne den eigenständigen Gutachtenauftrag des Betroffenen wäre das Gericht nicht auf den Fehler aufmerksam geworden, welcher letztendlich zur Einstellung des Verfahrens führte. Der Umstand, dass der Richterin eine solche Problematik aufgrund eines Parallelfalles bereits bekannt war, kann hier nicht beachtet werden.
Aufgrund der direkten Kausalität der Gutachtenanfertigung hinsichtlich der Einstellung des Verfahrens war dieses als notwendige Auslage nach §§ 46 Abs. 1 OWiG, 464 a Abs. 2 StPO auszulegen, was dazu führt, dass dem Beklagten die ausgelegten Kosten erstattet werden müssen.
Falls Sie in einen ähnlichen Fall verwickelt sind, überprüfen wir als Verkehrsrechtsexperten gerne für Sie, ob eine Eigeninitiative erfolgsversprechend und erstattungsfähig ist (generell übernimmt eine Rechtsschutzversicherung diese Kosten) – LG Bielefeld, Beschl. v. 19.12.2019 – 10 Qs 425/19.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht

Bereits mit Urteil vom 05.07.2016 entschied der BGH, dass eine unterbliebene Entschuldigung sowie ein fehlendes Bedauern des Angeklagten die Verhängung einer höheren Sperrfrist von einem Jahr und drei Monaten zur Neuerteilung eines Führerscheins nicht rechtfertigt.
Der Angeklagte wurde vom Landgericht Landshut wegen fahrlässiger Körperverletzung und versuchten Mordes in Tateinheit mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 4 Jahren und 10 Monaten verurteilt. Wegen unangemessen langer Verhandlungsdauer sollten 6 Monate als bereits vollstreckt gelten. Darüber hinaus wurde dem Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen, der Führerschein eingezogen und eine Neuerteilungssperre für 1 Jahr und 3 Monaten gem. § 69 a StGB verhängt.
Die verhältnismäßig lange Sperrzeit wurde vom Landgericht damit begründet, dass dem Geschädigten in der Hauptverhandlung vom Angeklagten kein Mitgefühl entgegengebracht worden war und er sich nicht entschuldigt oder sonstiges Bedauern an der Tat gezeigt hatte.
Gegen die Länge der verhängten Sperrfrist legte der Angeklagte Revision ein, die Erfolg hatte. Entgegen dem Urteil des Landgerichts legte der BGH lediglich die Mindestsperrfrist fest. Nach Auffassung des BGH lässt sowohl das Ausbleiben einer Entschuldigung, als auch das Fehlen eines zum Ausdruck gebrachten Bedauerns keinen Schluss auf eine rechtsfeindliche, durch besondere Rücksichtslosigkeit oder Gleichgültigkeit gegenüber Interessen und Rechtsgütern anderer geprägte Gesinnung oder Gefährlichkeit des Angeklagten zu. Daher darf sie genauso wenig wie bei der Strafzumessung bei der eignungsbezogenen Prognoseentscheidung im Rahmen des § 69 a StGB zum Nachteil des Angeklagten Berücksichtigung finden.
Zur Vermeidung einer teilweisen Zurückverweisung der Sache zur Neufestsetzung der Sperre nach § 69 a StGB, und um Benachteiligungen des Angeklagten auszuschließen, wurde in entsprechender Anwendung des § 354 Abs. 1 StPO die Neuerteilungssperre auf das sich angesichts der vorläufigen Entziehung der Fahrerlaubnis aus § 69a Abs. 4 Satz 2 StGB ergebende Mindestmaß von drei Monaten verkürzt (Urteil des BGH Juli 2016).
Bild: AdobeStock ©MQ-Illustrations 262673981
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Was vor allem Fahrzeugführer älterer Kraftfahrzeuge betrifft, sind die zahlreichen Umweltzonen, welche meist in größeren Ballungsgebieten festgelegt werden, um die Feinstaubbelastung vor Ort zu reduzieren. Passiert man eine solche Zone mit einem Fahrzeug ohne Umweltplakette oder unzureichender Schadstoffklasse, so erfüllt man den Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit, welche aufgrund der neuen StVO-Novelle vom 28.04.2020 mit einem Bußgeld von 100 EURO geahndet wird.
Im Jahr 2018 hat eine Entscheidung des Amtsgerichtes Marburg (Beschl. v. 25.02.2018 – 52 OWi 2/18) für Aufruhr in Verkehrsrechtskreisen gesorgt. Demnach solle die Plakette nur bei der Bewegung des Fahrzeuges gelten, das Parken ohne Plakette sei demnach restriktiv auszulegen, da durch diese Handlung kein Feinstaubausstoß erwirkt wird und die Plakette sinngemäß nur für den fließenden Verkehr Bedeutung entfaltet.
Der Beschluss aus Marburg erfährt nun Gegenwind aufgrund der Entscheidung des Amtsgericht Köln vom 02.05.2019 (813 OWi 5/19). Diesem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Betroffene habe sein Fahrzeug am 14.04.2018 in einer Umweltzone (Zeichen 270.1 – Grüne Plakette als Voraussetzung) geparkt, ohne die erforderliche Plakette aufzuweisen. Nachdem keinerlei Angaben zum Fahrzeugführer gemacht wurden, wurde das Bußgeldverfahren daraufhin eingestellt. Die Kosten wurden dem Fahrzeughalter auferlegt. Dagegen wehrt sich der Betroffene mit einem Antrag auf gerichtliche Entscheidung.
Mit einem Schreiben vom 11.03.2019 beruft er sich auf den Beschluss des Amtsgerichts Marburg, wonach keine Haftung des Halters bei Halten oder Parken des PKW in der Umweltzone ohne grüne Plakette bestehe.
Das Amtsgericht Köln teilt diese Rechtsauffassung jedoch nicht. Die Vorschrift des § 25 a StVG soll auch auf Parkvorgänge angewandt werden, wenn ohne Feinstaubplakette in ausgewiesenen Umweltzonen geparkt wurde. Das Zeichen 270.1 (Umweltzone) soll demnach auch im ruhenden Verkehr Anwendung finden, was auch ein Parken/Halten ohne Plakette in den Tatbestand integriert.
Als Begründung dafür zitiert das Gericht die 46. VO zur Änderung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften vom 01.09.2009. Demnach findet sich in der Gesetzesbegründung „BRDrs 153/09“, dass das Umweltzonen-Zeichen auch den ruhenden Verkehr umfassen soll. Als Sinn und Zweck der Begründung wird angeführt, dass es sonst zu erheblichen Auslegungsschwierigkeiten kommen könnte, welche dem legitimen Zweck des Einführens der Umweltzone zuwiderlaufen könnte. Des Weiteren stellt diese Auslegung sicher, dass auch im ruhenden Verkehr festgestellte Verstöße geahndet werden können, was eine Kostentragungspflicht nach § 25 a StVG nach sich zieht und eine Entlastungsmöglichkeit für die Verwaltungsbehörde mit sich bringt.
Letztendlich handelt es sich hier lediglich um amtsgerichtliche Entscheidungen erster Instanz. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Frage um das „Parken ohne Plakette“ weiterentwickelt. Zurzeit ist leider kein ähnlicher Sachverhalt bei einem höherrangigen Gericht anhängig, welcher nach höchstrichterlicher Rechtsprechung Klarheit bringen könnte. Der Konflikt zwischen dem AG Marburg sowie dem AG Köln bestätigt jedoch einen weiten Interpretationsraum der richterlichen Auslegung.
Falls Sie demnach in einen solchen Fall verwickelt wurden, ist es ratsam, einen Verkehrsrechtsexperten mit der Sache zu betrauen, um eine effiziente Verteidigung zu gewährleisten. Da die Rechtsprechung auf diesem Gebiet noch nicht gefestigt ist, bestehen hohe Chancen auf eine günstigere Einzelfallentscheidung, welche dann die Aufhebung des Bescheides mit sich bringen könnte.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Im Jahre 2017 hatten die Richter des OLG Nürnberg einen skurrilen Fall der Unfallschadensregulierung zu erörtern. Der Beklagte verlor die Kontrolle eines gemieteten Sportwagens, als er sich bei Tempo 200 km/h dem üppigen Infotainment-System der Luxuskarosse zuwandte. Die Autovermietung als Klägerin beruft sich auf grob fahrlässiges Verhalten des Beklagten. Dieser streitet jegliches Verschulden ab.
Der Rechtsstreit begann mit der Tatsache, dass sich der Beklagte bei der klagenden Autovermietung einen Mercedes CLS 63 AMG (550 PS) mietete. Nach dem Unfall ließ er sich demnach ein, dass er bis soeben keinerlei Erfahrungen mit solchen Sportwägen hatte, sondern lediglich eine ausgedehnte Probefahrt absolvieren wollte. Während dieser Fahrt beschleunigte er den Wagen auf ca. 200 km/h und erkundete simultan die zahlreichen Funktionen des sogenannten „Infotainmentsystems“ (Navi).
Aufgrund mangelnder Erfahrung musste er für eine verständliche Bedienung des Systems seinen Blickwinkel weitestgehend auf das Anzeigedisplay richten und vernachlässigte demnach die Straßenführung. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Mittelleitplanke, wodurch ein Karosserieschaden von ca. 12.000 EURO entstand. Der zugrundeliegende Mietvertrag enthält Nachbildungsklauseln einer Haftpflichtversicherung für solche Fälle, die Beteiligung schließt sich jedoch prozentual aus, sobald vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln nachgewiesen werden kann. Auf dieses grob fahrlässige Handeln beruft sich die klagende Autovermietung, mit dem Ziel, die Hälfte der Schadenssumme auf den Beklagten abzuwälzen.
Die Richter des Oberlandesgerichts Nürnberg folgten dieser Auffassung unter zahlreichen Argumenten.
Demnach stellt Tempo 200 in einem Kraftfahrzeug eine Geschwindigkeit dar, welche jenseits der empfohlenen Richtgeschwindigkeit liegt und extrem erhöhte Sorgfaltspflichten mit sich bringt, um den Straßenverkehr nicht zu gefährden. Diese Sorgfaltspflicht drückt sich meist dadurch aus, dass die eigene Aufmerksamkeit in besonderem Maße unter voller Konzentration auf das aktuelle Verkehrsgeschehen gerichtet sein muss.
Aufgrund der mangelnden Erfahrung mit dem Fahrzeugtyp und dem damit einhergehenden „Infotainmentsystem“ kann bei solchen derartigen Geschwindigkeiten der Vorwurf der groben Fahrlässigkeit begründet werden, da allein die weitgehende Blickabwendung vom Straßengeschehen bei diesem Tempo den Durchschnittsnutzer derart überfordert, dass dieser das Vehikel nicht mehr unter voller Konzentration führen kann. Diese Handlung rechtfertige auch den zumindest teilweisen Verlust der Haftungsfreistellung in den einer Kaskoversicherung nachgebildeten Bedingungen eines Mietvertrages.
Letztendlich sei auch das Vorhandensein eines sogenannten Spurhalteassistenten unbeachtlich, denn dieser könne den entsprechenden Schuldvorwurf zumindest bei derartig hohen Geschwindigkeiten nicht mehr beschränken, da bei steigendem Tempo dessen Funktionalität eingeschränkt werde.
Im Ergebnis folgten die Richter des OLG Nürnberg dem Klagebegehren der Autovermietung und verurteilten den Kläger zur hälftigen Zahlung der Schadenssumme aufgrund der Ausnahmeklausel im Mietvertrag.
OLG Nürnberg, Endurteil v. 02.05.2019 – 13 U 1296/17
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht

Mit seinem Beschluss vom 01.03.2019 hat das Oberlandesgericht (OLG) Köln entschieden, dass die Haftpflichtversicherung nicht für solche Schadensfälle aufzukommen hat, bei denen eine illegal betriebene Hanfplantage, die der gewerblichen Tätigkeit des Betreibers dient, abbrennt.
Ein Mann hatte auf dem Dachboden seiner Mietwohnung illegal eine Hanfplantage betrieben. Die hierfür benötigten Stromleitungen für die Heizgeräte hatte er selber laienhaft verlegt, wodurch es schließlich zu einem Brand kam, durch den das Gebäude erheblich beschädigt wurde.
Zum Ausgleich der daraus resultierenden Schadenersatz-Forderungen wandte sich der Mann an seine Privathaftpflicht-Versicherung. Diese lehnte eine Zahlung jedoch ab, da es sich bei dem Betreiben der Hanfplantage zum einen um eine nicht versicherte gewerbliche Tätigkeit handle. Zum anderen habe sich das Risiko einer ungewöhnlichen und gefährlichen Tätigkeit realisiert, das ebenfalls nicht vom Versicherungsschutz umfasst sei.
Der Mann stellte sodann einen Antrag auf Prozesskostenhilfe und führte zur Begründung an, dass er die Hanfplantage ausschließlich zur Deckung seines Eigenbedarfs betrieben habe.
Dem widersprach jedoch, dass die Polizei ca. ein Kilo Marihuana in der Wohnung gefunden hatte, was jedoch weitaus mehr als die vom Antragsteller angegebenen vier Gramm für den Eigenbedarf darstellt. Auch wurden eine Feinwaage sowie Aufzeichnungen über den Ernteerfolg sichergestellt. Daher wies der Richter den Einwand, die Ernte sei wider Erwarten „besonders gut“ ausgefallen zurück.
Das Gericht ging viel mehr davon aus, dass die Plantage dem Antragssteller zur Deckung des Lebensunterhalts diente, sodass es sich um eine nicht versicherte gewerbliche Tätigkeit gehandelt habe.
Der dauerhafte Einsatz von Heizgeräten und Leuchtmitteln ergibt, dass sich zusätzlich die Gefahr aus einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäftigung verwirklicht hat. Dadurch wurde die Gefahr eines Kurzschlusses mit der Folge eines Fremdschadens deutlich erhöht, auch deshalb, weil die Plantage und die Elektroinstallationen nicht ständig überwacht wurden. Insoweit wurde dem Einwand des Versicherers durch beide Instanzen stattgegeben.
Der Privathaftpflicht-Versicherer hat demnach zu Recht seine Eintrittspflicht abgelehnt (OLG Köln, März 2019).
Bild: AdobeStock ©MexChriss 284105684
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht

Eines der schwerwiegendsten Grundrechtseingriffe und die mächtigste Waffe der Verwaltungsbehörden stellt wohl die Erzwingungshaft nach § 96 OWiG dar, welche die Behörden dazu ermächtigt, die Maßnahme des Freiheitsentzuges anzuordnen, weil eine durch eine Ordnungswidrigkeit verursachte Geldbuße nicht ordnungsgemäß bezahlt wurde.
Jedoch muss sich auch solch ein Eingriff innerhalb der Grundsätze der Verfassung bewegen, damit die Maßnahme keine Rechtswidrigkeit aufweist. Dies wird meist durch die Verhältnismäßigkeitsanforderung geregelt, welche auf dem Grundsatz des Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes fußt. Demnach muss die Sanktion auf der einen Seite mit dem schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte des Betroffenen auf der anderen Seite abgewogen werden. Stellt die Sanktion einen verständlichen Eingriff dar, so gilt sie als verhältnismäßig.
Aufgrund des scharfen Schwertes der Erzwingungshaft sind die deutschen Gerichte deshalb angeraten, die Verhältnismäßigkeit solcher Zwangsmaßnahmen detailliert zu überprüfen, um dem Prinzip der Gewaltenteilung gerecht zu werden. So geschah es auch in dem Beschluss des AG Dortmund vom 14.01.2019 (729 OWi 1/19).
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Betroffene hat sich ein Verstoß gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz zulasten kommen lassen, da er an einem Hauptbahnhof eine Zigarettenkippe auf den Boden warf, was mit einer Geldstrafe von 15 € geahndet wurde. Trotz mehrfacher Anmahnung verweigerte der Beklagte die Zahlung. Die Verwaltung sah sich gezwungen, die Zahlungsunwilligkeit des Betroffenen bezüglich des Bescheids über 15 € (!) durch die Anordnung einer Erzwingungshaft zu sanktionieren.
Nach mangelnder Rückmeldung bezüglich des Betroffenen zum Haftantritt wurde dieser an seiner angegebenen Meldeadresse aufgesucht. Das Aufsuchen der Wohnung des Betroffenen führte zu der Erkenntnis, dass sich dieser in Haft befinde.
Dies führte zur Überprüfung seiner Zahlungsfähigkeit, denn nur bei Vorliegen dieser ist die Anordnung einer Erzwingungshaft nach § 96 OWiG überhaupt möglich.
Nach Rücksprache mit der verwahrenden JVA am 12.11.2018 wurde den Beamten mitgeteilt, dass der Beklagte von dortaus keine pfändbaren Beträge abführen könne. Weitere Erkenntnisse über das Vermögen sowie die Einkünfte des Betroffenen konnten nicht festgestellt werden, da die Vollstreckungsbehörde über die einfachen Zahlungsaufforderungen keine weiteren Vollstreckungshandlungen entfaltet hat.
Bezüglich des Umstandes, dass sich der Beklagte bereits innerhalb einer JVA befinde und zudem nach den Feststellungen der Verwaltungsbehörde zahlungsunfähig ist, sind einerseits die Voraussetzungen des § 96 OWiG nicht als erfüllt anzusehen, andererseits würde die bestehende Lage aufgrund der bereits eingetretenen Zahlungsunfähigkeit sowie der Freiheitsentziehung einer Verhältnismäßigkeitsprüfung der Maßnahme nicht standhalten.
Das Amtsgericht Dortmund hat den Antrag auf Anordnung der Erzwingungshaft zurückgewiesen.
Amtsgericht Dortmund: Beschluss vom 14.01.2019 – 729 OWi 1/19 (b)
Bild: AdobeStock ©sakhorn38 216845226
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht
Die Richter des Landgerichtes Hagen mussten sich in ihrem Beschluss vom 17.12.2018 mit der Verhältnismäßigkeit einer Wohnungsdurchsuchung aufgrund einer einfachen Geschwindigkeitsüberschreitung beschäftigen. Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im März 2017 wurde eine durch den Beklagten begangene Geschwindigkeitsüberschreitung von 60 km/h außerorts festgestellt, wodurch er vor dem Amtsgericht zu einer Geldbuße von 600 EUR sowie einem einmonatigen Fahrverbot verurteilt wurde. Gegen diese Entscheidung wandte sich der Beklagte mit einer Rechtsbeschwerde zum Oberlandesgericht.
Das Oberlandesgericht folgte der tatbestandlichen Feststellung des Amtsgerichtes, kritisierte jedoch den Rechtsfolgenausspruch hinsichtlich mangelnder Feststellung der Vermögenslage des Betroffenen im Hinblick auf die ausgesprochene Sanktion und verwies die Sache zurück an das erstinstanzlich-zuständige Amtsgericht.
Daraufhin versuchte das Amtsgericht, die Vermögensverhältnisse des Beklagten festzustellen. Aufgrund mangelnder Auskunft durch den Beklagten sowie seinen Verteidiger blieb der Versuch ergebnislos. Um eine Feststellung dennoch zu ermöglichen, ordnete das Amtsgericht formell rechtmäßig durch richterlichen Beschluss eine Durchsuchung der Wohnung des Verurteilten an, um dort Informationen über dessen Vermögenslage zu beschaffen. Auch dagegen wandte sich der Betroffene mit einer Rechtsbeschwerde zum Landgericht.
Das Landgericht wies die Rechtsbeschwerde als unbegründet ab. Dies untermauerten die Richter mit folgender Begründung:
Die Wohnungsdurchsuchung des Betroffenen war nach § 46 Abs. 1 OWiG iVm. §§ 102,103 StPO als rechtmäßig durchgeführt festzustellen. Das Amtsgericht hatte in der Anordnung ausreichend begründet, dass nur solche Gegenstände gesucht werden sollen, welche Auskünfte über die Vermögenslage des Betroffenen preisgeben. Der sogenannten „Umgrenzungsfunktion“, welche vom Bundesverfassungsgericht seit 2006 verlangt werde (BVerfG, Nichtannahmebeschluss vom 14. Juni 2006 – 2 BvR 1117/06), wurde vom Amtsgericht genüge getan.
Des Weiteren war die Anordnung auch vom Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gedeckt. Am legitimen Zweck als auch an der Geeignetheit der Maßnahme sahen die Richter des LG keinen Zweifel. Fraglich war jedoch, ob eine Durchsuchung als erforderlich einzustufen war, also das mildeste Mittel bei gleichbleibender Effizienz darstellte.
Demnach begründete das LG, dass die Beamten keinerlei andere Möglichkeiten besaßen, um an die zur Feststellung benötigten Informationen zu gelangen.
Eine Einkommensschätzung anhand des geführten Fahrzeuges, wie vereinzelt in der Rechtsprechung gehandhabt (OLG Köln, Beschluss vom 04. März 2011 – III-1 RBs 42/11), konnte im geschilderten Fall nicht vorgenommen werden, da keine hinreichende Feststellung über die Eigentumslage des Fahrzeugs möglich war. Der Beklagte ließ sich mit der Behauptung ein, dass Fahrzeug lediglich gemietet zu haben. Gegen diese Annahme sprach jedoch die Verwendung seiner Initialen auf dem Kennzeichen. Für eine Feststellung reichte diese Beweislage jedoch nicht aus.
Eine mildere Maßnahme würde die automatisierte Datenbereitstellung bezüglich der Konten des Beklagten darstellen. Solch ein Zugriff durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) ist jedoch nur unter besonderen Voraussetzungen möglich, welche in § 24c Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 KWG geregelt ist. Darunter fallen jedoch lediglich Straftaten, keine Ordnungswidrigkeiten, wodurch diese Maßnahme ausscheidet.
Auch die Anfrage einer hinterlegten Kontonummer beim Kraftfahrtbundesamt führte nicht zu dem gewünschten Ergebnis, sondern könnte lediglich durch einen notwendigen Zugriff auf Informationen Dritter Erfolg versprechen, was jedoch auch Maßnahmen gegen Unbeteiligte mit sich ziehe, was dem Verhältnismäßigkeitsrahmen sprengen würde. Somit war die Durchsuchung erforderlich.
Hinsichtlich der Abwägung rechtlich geschützter Interessen kam das Landgericht zu keinem anderem Ergebnis. Eine Ordnungswidrigkeit schließe eine Durchsuchungsmaßnahme nach den §§ 102, 103 StPO schon systematisch nicht aus, da § 46 Abs. 1 OWiG drauf verweise.
Des Weiteren gelte auch bezüglich der Bußgeldhöhe keine pauschale Unter – oder Obergrenze, ab wann eine Hausdurchsuchung unverhältnismäßig sei, denn es komme immer auf die Verhältnismäßigkeit im Einzelfall an, welche hier vom Amtsgericht auch richtig ermittelt wurde. Indizien dafür stelle die Schwere der Tat (60 km/h außerorts überschritten) sowie zahlreiche Voreintragungen dar, welche die hohe Leichtfertigkeit des Täters sowie dessen Gefährdungspotential widerspiegeln.
Letztendlich waren die Verhältnismäßigkeitsanforderungen für eine Hausdurchsuchung seitens des LG Hagen erfüllt, die Rechtsbeschwerde wurde als unbegründet verworfen.
An dieser Entscheidung ist zu erkennen, dass auch „kleinere“ Vergehen im Ordnungswidrigkeitsbereich große Einschnitte in die bürgerlichen Grundrechte begründen können. Dieser Beschluss stellt jedoch keinen Freifahrtschein für Behörden dar, sondern untermauert die Wichtigkeit der Verhältnismäßigkeitsprüfung im Einzelfall.
Falls auch Sie Opfer einer solchen Maßnahme wurden, ist es ratsam, schnellstmöglich einen Experten auf diesem Gebiet aufzusuchen, um die Rechtmäßigkeit der Maßnahme überprüfen zu können und effektive Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Strafrecht