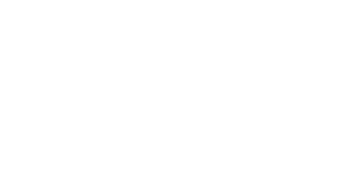Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Der Bundesgerichtshof hatte im Februar 2018 eine weitere Frage bezüglich des Belehrungsrechtes aus § 136 Abs. 1 StPO sowie dem damit zusammenhängenden Beweisverwertungsverbotes zu klären. Der Angeklagte wandte sich mit einer Revision nach Karlsruhe, da er nicht über die Möglichkeit der Bestellung eines Pflichtverteidigers nach § 136 Abs. 1 Satz 5 2. Halbsatz StPO belehrt wurde.
Dem StPO-trächtigen Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte wurde in einem Prozess vor dem Landgericht Erfurt bezüglich eines gemeinschaftlich begangenen Mordes zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Gegen das Urteil legte dieser Revision zum Bundesgerichtshof ein. Dort machte er mit einer Verfahrensrüge geltend, dass die Angaben bei seiner Vernehmung einem Beweisverwertungsverbot unterliegen würden, da die Beamten ihm entgegen § 136 Abs. 1 Satz 5 2. Halbsatz StPO im Rahmen der polizeilichen Vernehmung nicht darüber belehrt haben, dass ihm unter den Voraussetzungen des § 140 StPO ein Pflichtverteidiger zur Seite bestellt werden könne.
Der BGH hielt die Verfahrensrüge für gegenstandslos und wies die Revision zurück. Diese Entscheidung begründeten die Bundesrichter aus Karlsruhe wie folgt:
Zwar sei eine notwendige Belehrung bezüglich des Pflichtverteidigerangebotes seitens der Beamten nicht erfolgt. Ein absolutes Beweisverwertungsverbot könne bei einer Verletzung des § 136 Abs. 1 Satz 5 2. Halbsatz StPO jedoch nicht hergeleitet werden. Anzeichen dafür finden sich weder im Gesetz, noch der zugrundeliegenden Richtlinie 2012/13/EU über das Recht auf Belehrung und Unterrichtung im Strafverfahren als auch nicht in den Gesetzgebungsmaterialien zur StPO.
Damit es zu einem solchen Beweisverwertungsverbot komme, müsse es dem Angeklagten vollumfänglich verhindert werden, Zugang zu einem Verteidiger zu bekommen, so dass dieser der Strafverfolgung im Sinne der Exekutive schutzlos ausgeliefert ist. Dies war in der oben geschilderten Konstellation jedoch nicht der Fall.
Hinzu kommt, dass der Angeklagte im Ermittlungsverfahren kein eigenes Antragsrecht auf die Beiordnung eines Pflichtverteidigers aus § 136 Abs. 1 Satz 5 2. Halbsatz StPO zustehe, sondern lediglich ein „Anregungsrecht“, wodurch die Staatsanwaltschaft tätig werden muss und aus eigener Handlung einen Pflichtverteidiger für den Angeklagten bestellt.
Somit sprechen Wortlaut als auch Gesetzessystematik gegen die Annahme eines absoluten Beweisverwertungsverbotes aufgrund der unterbliebenen Belehrung über die Bestellung eines Pflichtverteidigers.
Dennoch steht die Annahme eines relativen, einzelfallbezogenen Beweisverwertungsverbot im Raum. Dagegen spricht jedoch, dass die Belehrung seitens der Beamten nicht bewusst und willkürlich unterlassen wurde, sondern aus Unkenntnis bezüglich der StPO-Neuregelung zum diesem Thema. Zudem kommt hinzu, dass bei einem Tötungsdelikt das Verfolgungs – und Aufklärungsinteresse besonders hoch sei, ein Verstoß gegen eine „kleine“ Formalie diese erlangten Informationen jedoch nicht zunichte machen darf. Letztendlich ist darauf einzugehen, dass der Angeklagte selbst keinerlei Angaben und Informationen preisgab, dass er mangels wirtschaftlicher Mittel keine Möglichkeit sieht, sich eines Verteidigers zu bedienen. Schließlich habe er seinen Wunschverteidiger kontaktieren können und es musste kein Antrag auf Pflichtverteidigung seitens der Staatsanwaltschaft gestellt werden. Somit sei auch ein relatives Beweisverwertungsverbot abzulehnen (BGH, Beschluss vom 06.02.2018 – 2 StR 163/17:
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Bundesgerichtshof musste sich in einem Beschluss aus dem Jahre 2018 erneut mit der Konkretisierung des Strafprozessrechtes auseinandersetzen. Dort hat ein Schöffe eine Einlassung des Angeklagten mit dem Worten „Quatsch“ unterbrochen, was seitens der Richter aus Karlsruhe eine Befangenheit bestätigt und den Austausch des Schöffen rechtfertigt.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Vor dem Landgericht Potsdam fand gegen den Angeklagten ein Strafverfahren wegen Brandstiftung und Sachbeschädigung statt. Gleich am ersten Verhandlungstag begann der Angeklagte, eine schriftliche Erklärung bezüglich seiner Tathandlung vorzulesen. Während dieser Einlassung kam es dazu, dass der beisitzende Schöffe sich plötzlich mit den Worten gegenüber dem Einlassenden äußerte, ob dieser „tatsächlich an diesen Quatsch glaube, welchen er hier erzähle“. Aufgrund dieser Äußerung lehnte der Angeklagte den Schöffen als befangen ab. Dieser entschuldigte sich zwar im Rahmen einer dienstlichen Äußerung mit dem Argument, dass er lediglich wissen wollte, ob der Angeklagte die Einlassung ernst meinte oder es sich dabei um einen für alle „erkennbaren provozierenden Unsinn“ handelt.
Der Befangenheitsantrag wurde einer anderen Strafkammer zur Entscheidung vorgelegt. Diese lehnte den Antrag aufgrund der Äußerung jedoch ab und begründet dies damit, dass der Schöffe lediglich eine verständliche Unmutsäußerung getätigt habe und in der dienstlichen Erklärung nachvollziehbar dargestellt hat, warum es zu dieser Reaktion gekommen ist. Zudem habe er sich entschuldigt und seine für den weiteren Verhandlungsverlauf fortbestehende Objektivität gegenüber dem Angeklagten versichert. Dies reichte der entscheidungsbemächtigten Strafkammer aus, der Antrag wurde abgewiesen, der Angeklagte wurde durch die Kammer, in welcher auch der Schöffe dient, verurteilt. Dagegen wandte sich der Angeklagte mit einer Revision zum Bundesgerichtshof.
Dieser entschied zu Gunsten des Angeklagten, hob die ergangene Entscheidung des Landesgerichts gegen ihn auf und wies die Sache mit der Forderung zur Neuverhandlung an eine andere Strafkammer des Landesgerichts zurück. Diese Entscheidung wurde durch die Mitwirkung des Schöffen begründet, welcher wegen der Besorgnis der Befangenheit hätte abgelehnt werden müssen. Dieses Gesuch wurde gemäß den Richtern des BGH zu Unrecht verworfen. Das Urteil musste somit aufgehoben werden.
Nach der Ansicht des Bundesgerichts habe die Aussage des Schöffen ein Misstrauen bezüglich seiner Unparteilichkeit erweckt, was eine Befangenheit rechtfertigte. Diese „grob unsachliche“ Bemerkung und die Entscheidung, die Einlassung des Angeklagten zu unterbrechen und daraufhin nicht mehr zu folgen, weil er diese subjektiv für Unsinn hielt, sei laut den Richtern keine unbeachtliche „Unmutsaufwallung“, sondern zerstöre die Neutralität des Rechtspflegevorgangs bei Gericht. Es sei dem Schöffen nicht darum gegangen, dem Angeklagten auf gewisse Bedenken seiner Äußerung hinzuweisen, sondern die getätigten Aussagen gezielt zu diskreditieren. Dies zeige nicht nur die Wortwahl, sondern auch der Umstand, dass er das Ende der Einlassung nicht abgewartet hatte.
Die begehrte „Heilung“ durch die dienstliche Äußerung des Schöffen sei nicht ausreichend gewesen, um die verursachte Unparteilichkeit zu beseitigen. Diese war viel mehr dazu geeignet, um das bereits angefallene Misstrauen noch weiter zu vertiefen. Der Schöffe habe deutlich gemacht, dass er die Einlassung des Angeklagten weiterhin als nicht ernst gemeint oder als Unsinn bewertet. Die darauffolgende Aussage, dass er sich von nun an objektiv verhalte, sei unbeachtlich, da ein bereits bestehendes Misstrauensverhältnis durch solch eine Aussage nicht wieder in den Urzustand versetzt werden kann (BGH, Beschluss vom 06.03.2018 – 3 StR 559/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt musste sich im Jahre 2018 mit der Strafbarkeit zweier Tierschützer auseinandersetzen, welche in einen Schweinemastbetrieb eingebrochen sind, um die dortigen Gesetzesverstöße gegen die Tierschutznutztierverordnung zu dokumentieren. Das OLG sah einen rechtfertigenden Notstand nach § 34 StGB erfüllt, welcher der Strafbarkeit der Handlung entgegensteht.
Das Urteil ergab sich aus folgender Konstellation:
Die beiden Tierschützer wurden aufgrund des Einbruchs in den Mastbetrieb nach § 123 StGB wegen Hausfriedensbruch angeklagt. In diesem Mastbetrieb soll es laut anonymen Quellen zu zahlreichen Gesetzesverstößen gegen die Tierschutznutztierverordnung gekommen sein. Trotz erfolgter Anzeige gegenüber den zuständigen Behörden wurde nicht unternommen. Die angefertigten Bildaufnahmen, welche während des nächtlichen Einbruches erstellt wurden und etwaige Verstöße dokumentierten, wurden an das Landwirtschaft – und Umweltministerium sowie das Landesverwaltungsamt von Sachsen – Anhalt weitergeleitet. Zudem erstatteten die beiden Tierschützer ebenfalls Anzeige gegen den Mastbetrieb.
Die Anzeige aufgrund Hausfriedensbruchs führte zum Prozess am Amtsgericht Haldensleben. Der Tatrichter sprach die beiden Angeklagten frei und berief sich dabei auf den rechtfertigenden Notstand (§ 34 StGB) als auch auf das Nothilferecht (§ 32 StGB). Die Berufung wurde am Landgericht Magdeburg verhandelt. Dessen Richter kamen zu dem exakt selben Ergebnis und sprachen die Angeklagten frei. Dies war der Staatsanwaltschaft ein Dorn im Auge, weshalb diese Revision zum Oberlandesgericht einlegte. Sie stützte sich auf das Argument, dass ein rechtfertigender Notstand nicht greife. In der Konstellation waren zwar die gehaltenen Schweine gefährdet, jedoch sei konkludent auszulegen, dass der Halter der Schweine trotz Gefährdung den Hausfriedensbruch der Tierschützer offensichtlich nicht gewollt habe.
Das Oberlandesgericht Sachsen-Anhalt bestätigte die Entscheidung der Vorinstanz und wies daher die Revision der Staatsanwaltschaft zurück. Die Tierschützer seien demnach nicht gemäß § 123 StGB zu verurteilen. Nach der zutreffenden Begründung des Landgerichts lag ein rechtfertigender Notstand im Sinne des § 34 StGB vor. Die Richter lehnten die Auffassung der Staatsanwaltschaft ab, wonach ein Vorgehen gegen die Misshandlung der Tiere nur dann unter § 34 StGB falle, wenn der Eigentümer der Tiere dies billige. Dies würde zu nicht nachvollziehbaren Ergebnissen kommen und die Wirkung des § 34 StGB untergraben. Der subjektive Wille des Tierhalters dürfe in diesem Fall keine Rolle spielen. Ansonsten wäre der Fall gegeben, dass ein erstickender Hund in einem nicht-gekühlten Fahrzeug nicht gerettet werden dürfe, sobald der Besitzer subjektiv davon ausgehe, dass dem Hund schon nichts passieren würde. Spricht man sich gegen diesen Gedanken aus, wie auch die Richter des OLG Sachsen-Anhalt, so ist hier ein rechtfertigender Notstand nach § 34 StGB bezüglich des Einbruches zu bejahen.
Eine Rechtfertigung wegen Nothilfe nach § 32 StGB wurde seitens des OLG jedoch abgelehnt. Die Tierschützer hatten wohl nicht die Absicht, die sich in dem Zeitpunkt des Einbruchs im Schlachthof befindlichen Tiere vor Gefahren durch die Verstöße zu schützen, denn legt man die Zeitachse lebensnah aus, so vergeht eine bestimmte Zeit bis es zur Besserung der Situation kommt und die Verstöße abgeschafft werden. In dieser Zeit wurden die gegenwärtigen Tiere jedoch längst geschlachtet. Demnach wäre die Anwendung des § 32 StGB in der vorliegenden Konstellation verfehlt.
Als Schlussbemerkung betonten die Richter des OLG jedoch noch einmal die Ausnahmekonstellation des § 34 StGB. Dieser komme im vorliegenden Fall lediglich in Betracht, da den Eingreifenden die Tatsachen (Tierschutzverstöße) bekannt seien, welche letztendlich zur Rechtfertigung führte. Durch die wiederholte Anzeige solcher Verstöße gegenüber den Behörden kann von einem sicheren Wissen ausgegangen werden. Da die Behörde im konkreten Fall keine Nachforschungen anstellte und somit ihre Aufgabe nicht erfüllte, wurde den Tierschützern ein Recht eröffnet, der Sache selbst „in einem angemessenen Rahmen“ auf den Grund zu gehen, was diese durch die Dokumentation der Verstöße auch taten.
Würde es sich lediglich um eine Vermutung bezüglich der Verstöße handeln oder die Behörde bereits Tätigkeiten entfaltet haben, so wäre eine Notstandslage zu verneinen und § 34 StGB zu versagen. Aufgrund der schwierigen Umstände und das Unterlassen einer Handlung seitens der Behörde liegt jedoch eine spezielle Notstandslage vor, welche die Angeklagten rechtfertigte (OLG Sachsen-Anhalt, Urteil vom 22.02.2018 – 2 Rv 157/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Landgericht Osnabrück musste im Urteil vom 18.06.2020 über die Sanktion einer 68-jährigen Realschullehrerin entscheiden, welche sich vor dem Gericht wegen Betruges in Tateinheit mit Urkundenfälschung in 112 Fällen verantworten muss. Die Richter entschieden auf eine Gesamtfreiheitsstrafe von 2 Jahren und 11 Monaten.
Du diesem hohen Strafmaß kam es wie folgt:
Die besagte Beamtin hat in einem Zeitraum von mehr als vier Jahren in 112 Fällen Medikamentenrezepte gefälscht. Sie benutzte Vordrucke, welche Sie dann täuschungsecht mit größeren Mengen an Medikamenten versah, um eine möglichst hohe Summe zu erzielen. Sie nutzte die Fälschung in der Hinsicht, um diese bei der Beihilfestelle Niedersachsen einzureichen, damit diese ihrer Leistungspflicht im Sinne der Rückzahlung eines Großteils der Summe der Medikamente nachgehe. In der Folge erhielt die Angeklagte Erstattungen für Medikamente, welche Sie weder tatsächlich bezahlt noch erhalten hatte.
Aufgrund der Vielzahl der Einreichungen und damit verbundenen Zahlungen der Behörde summierte sich der Schaden letztendlich auf 903.558,30 €.
Das Landgericht Osnabrück hatte die Angeklagte bereits wegen dieser Taten im November 2018 zu einer Freiheitsstrafe von 2 Jahren und 10 Monaten verurteilt, jedoch hatte der Bundesgerichtshof aufgrund einer Revision seitens der Angeklagten dieses Urteil bereits im Sommer 2019 teilweise aufgehoben. Der Schuldspruch sowie die Feststellungen zur Sache wurden seitens der Richter in Karlsruhe bestätigt. Aus Sicht des BGH waren jedoch weitere Prüfungen bezüglich des Strafmaßes notwendig. Es stand im Raum, ob der Angeklagten eine besondere Strafmilderung zugutekommen soll, da diese bereits während des Ermittlungsverfahrens einer Verwertung ihrer privaten Güter zustimmte, woraus eine Schadenswiedergutmachung von ca. 700.000 € erwirtschaftet werden konnte.
Trotz der Schadensbegrenzung von knapp 80 % der erbeuteten Summe kam die Kammer des Landesgerichts Osnabrück zu dem Entschluss, dass auch unter Berücksichtigung dieses Aspekts die Taten zu der geforderten Gesamtfreiheitsstrafe verhältnismäßig und dadurch tat – als auch schuldangemessen sind.
Während das Verfahren zwischenzeitlich beim Bundesgerichtshof aufgrund der Revision anhängig war, wurde die Angeklagte bereits ein weiteres Mal aufgrund eines Straßenverkehrsdeliktes verurteilt. Diese noch nicht vollstreckte Strafe war in die neu zu bildende Gesamtstrafe durch Umrechnung der Haftzeit miteinzubeziehen.
Letztendlich führte dieser Umstand dazu, dass die Angeklagte im Ergebnis sogar zu einer längeren Haftstrafe (um einen Monat) verurteilt wurde, als dies in der ersten Entscheidung des Landgerichts Osnabrück der Fall war (LG Osnabrück, Urteil vom 18.06.2020- 35 KLs 3/18).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Oberlandesgericht Hamm musste sich im Jahre 2013 mit den Voraussetzungen des Nötigungstatbestandes nach § 240 StGB auseinandersetzen. Dort wurde eine Revision über einen „erzwungenen Kuss“ verhandelt.
Das Urteil fußt auf folgendem Sachverhalt:
Ein 49 – Jähriger Essener erteilte der Geschädigten wöchentlich Gitarrenunterricht in einer Musikschule. Nachdem er über einen längeren Zeitraum versuchte, dem Opfer durch verbale Annäherung näher zu kommen, wies diese die Forderungen zurück und äußerte sich, dass sie so etwas nicht wolle und lediglich aufgrund des Musikunterrichts Zeit mit ihm verbringt. In einer Situation, in welcher sich beide frontal gegenüberstanden, zog der Angeklagte die Geschädigte zu sich hin, so dass Sie aufgrund des Gleichgewichtsverlustes nicht mehr ausweichen konnte und küsste diese auf den Mund.
Das Opfer zeigte den Mann an. Im zugrundeliegenden Strafverfahren ließ sich der Angeklagte ein, dass in seinem gezeigten Verhalten keine strafbare Nötigung gesehen werden könne, da er keinerlei Gewalt ausgeübt und die Geschädigte beispielsweise während des Kusses auch nicht festgehalten hat.
Das Landgericht hat das Verhalten des Angeklagten zu Recht als Nötigung gemäß § 240 Abs. 1 StGB gewertet. Demnach hat der Angeklagte gegenüber der Geschädigten Gewalt angewendet und dadurch die Duldung eines Verhaltens – den Kuss auf den Mund der Geschädigten – erzwungen.
Kennzeichnend für die Anwendung von Gewalt ist neben einer körperlichen Kraftentfaltung des Täters auch die hierdurch verursachte unmittelbare physische Zwangswirkung auf das Opfer. In dieser Hinsicht reicht das tatsächliche Anfassen und Heranziehen der Geschädigten bereits aus, um diese körperliche Kraftentwicklung im Sinne des Gewaltenbegriffs nach § 240 Abs. 1 StGB anzunehmen.
Damit jedoch eine erzwungenes Verhalten angenommen werden kann, müsse ein entgegenstehender Wille überhaupt vorhanden sein. Denn wer keinen Willen zu einem bestimmten Verhalten hat, kann nicht zu Gegenteiligem gezwungen werden. Demnach würden überraschende, das Opfer lediglich „überrumpelnde“ Handlungen ausscheiden, auch wenn die betroffene Person diese nicht will. Diesen entgegenstehenden Willen habe das Oper jedoch bereits vor der Tat klar zum Ausdruck gebracht. Im Fall eines wie hier vorliegenden sexuell motivierten Täterverhaltens kann der entgegenstehende Wille selbstverständlich auch im Zusammenhang mit zunächst verbalen Anzüglichkeiten des Täters geäußert werden. Demnach kann hier nicht von einem „überraschenden“ Verhalten des Angeklagten ausgegangen werden, welches in bestimmten Konstellationen den Gewaltbegriff des § 240 Abs. 1 StGB entfallen lässt.
Da bereits das Heranziehen der Geschädigten als Gewalt zu qualifizieren war und der Nötigungserfolg bereits mit dem Erdulden des Kusses eingetreten war, kam es auch nicht darauf an, ob der Angeklagte die Geschädigte während des Kusses weiter festgehalten hat. Auch dies wurde seitens des Landgerichtes zutreffend gewürdigt, so dass eine Revision als unbegründet verworfen wurde (OLG Hamm, Beschluss vom 26.02.2013 – III-5 RVs 6/13).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Bundesgerichtshof hat sich im Jahre 2013 erstmalig ausgiebig mit der Strafbarkeit bezüglich heimlicher Personenüberwachungen zu privaten Zwecken beschäftigen müssen. In diesem Fall wurde vor allem die GPS-Technik für die Dauerüberwachung genutzt.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Das Landgericht Mannheim hat den Betreiber einer Detektei sowie einen seiner Angestellten wegen gemeinschaftlicher vorsätzlicher unbefugter Erhebung von Daten gegen Entgelt in mehreren Fällen zu Freiheitsstrafen verurteilt.
Die Angeklagten haben gegen Bezahlung angeboten, für ihre privaten Auftraggeber Überwachungsaufträge auszuführen, welche beispielsweise Erkenntnisse über das Berufs – oder Privatleben der überwachten Person ans Licht brachten. Die Auftraggeber handelten mit unterschiedlichen Motiven. Meist ging es um wirtschaftliche Interessen wie das Vortäuschen von Arbeitsunfähigkeiten über einen längeren Zeitraum, oder das Austauschen von sensiblen Firmeninformationen. Es gab jedoch auch Fälle, welche das private Interesse der Mandanten abzielten, welche meistens auf Eheauseinandersetzungen bezogen waren und Affären aufdecken sollten.
Überwiegend wurden zur Erfüllung dieser Aufträge Foto – und Videomaterial der betroffenen Personen angefertigt. Zudem kam es dazu, dass die Angeklagten sich in großem Umfang der GPS-Technik bedienten, vor allem überwachten Sie mehrere „Zielpersonen“ mit einem unbemerkt am Fahrzeug angebrachten GPS-Empfänger. Auf diese Weise wurde es der Detektei ermöglicht, Bewegungsprofile der Personen anzufertigen und so sensible Informationen zu erheben.
Auf Grundlage der Feststellungen des Landgericht Mannheim haben die Angeklagten eine Reihe strafbarer Verstöße gegen das Bundesdatenschutzgesetz begangen. Primär fehlte es an der Befugnis, nach §§ 28 Abs. 1 Nr. 2, 29 Abs. 1 Nr. 1 BDSG solche GPS-Empfänger einzusetzen. Jedoch wurde von dieser Instanz keinerlei Differenzierung zwischen den Einzelfällen vorgenommen.
Mit der Revision zum Bundesgerichtshof haben sich de Angeklagten unter anderem gegen die rechtliche Bewertung des Landgerichts gewehrt, die Datenerhebung sei unbefugt gewesen. Eine einzelfallbezogene Abwägung des Persönlichkeitsrechtes, sowie der widerstreitenden Interessen habe das Landgericht gänzlich unterlassen.
Der 1. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat daraufhin entscheiden, dass die heimliche Überwachung einer privaten Zielperson mittels eines GPS-Empfängers grundsätzlich als strafbar einzustufen sei. Jedoch sind auch in solchen Fällen Ausnahmen zulässig. Bei starken berechtigten Interesse an der Datenerhebung können Ausnahmesituationen wie beispielsweise eine Notwehrsituation nach § 32 StGB ergeben, dass das Merkmal des unbefugten Handelns beim Einsatz solcher GPS-Empfänger zu verneinen ist.
Ob eine solche Ausnahme in einigen der gezeigten Fälle vorlag, konnte vom Bundesgerichtshof nicht abschließend geprüft werden, da seitens des Landgerichts keine ausreichenden Feststellungen getroffen wurden. Dies führte zur Aufhebung und Zurückverweisung eines Teils der angeklagten Fälle an eine andere Strafkammer des Landesgerichts, mit der Bitte, weitere Feststellungen zu den Einzelfällen zu treffen und etwaige Abwägungen hinsichtlich der berechtigten Interessen vorzunehmen.
Bei den Fällen, in welchen die Feststellungen ausreichend waren und ein berechtigtes Interesse aufgrund der Beweislage als ausgeschlossen galt, hatten die Schuldaussprüche Bestand (BGH, Urteil vom 04.06.2013 – 1 StR 32/13).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Die Richter des Bundesgerichtshofes mussten sich mit diesem Beschluss aus dem Jahre 2017 erneut in die tiefen Abgründe der strafrechtlichen Rechtsdogmatik begeben und einen rechtswissenschaftlichen Klassiker, die Abgrenzung zwischen Raub und räuberischer Erpressung, erneut aufarbeiten.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein Bankkunde betritt eine Sparkasse und steht routinemäßig vor einem Geldautomaten, um dort eine bestimmte Summe an Bargeld abzuheben. Nachdem dieser seine Bankkarte in das Lesegerät des Automaten geschoben und seine Geheimnummer korrekt eingegeben hat, wird er vom Täter weggeschubst und geht zu Boden. In dieser Zeit wählt der Täter einen Auszahlungsbetrag von 500 € und entnimmt das vom Geldautomaten ausgegebene Bargeld, um sich zu Unrecht zu bereichern.
Der BGH musste demnach entscheiden, ob die Strafbarkeit eines Raubes oder einer räuberischen Erpressung erfüllt ist. Die Richter begründeten das Urteil wie folgt:
Ein Raub nach § 249 Abs. 1 StGB liegt im oben genannten Fall nicht vor. Das vorinstanzliche Landgericht stellte richtigerweise fest, dass die Geldscheine für den Täter bereits eine fremde bewegliche Sache im Sinne des § 249 Abs. 1 StGB waren, denn diese standen zum Tatzeitpunkt noch immer im Eigentum der Sparkasse und wurden aufgrund der noch nicht ausgeführten „Handübereignung“ auch noch nicht in das Vermögen des Opfers übertragen. Adressat des Ausgabevorgangs ist stets der mit der Bank durch den Girovertrag verbundene Kunde, niemals ein unberechtigter Benutzer des Geldautomaten. Dies solle laut den Richtern aus Karlsruhe auch dann gelten, wenn der Automat bis zum Zeitpunkt des Vorfalles ordnungsgemäß vom Opfer bedient wurde.
Des Weiteren müsste der Täter die Geldscheine „weggenommen“ haben, also fremdes Gewahrsam brechen und neues Gewahrsam begründen. Dies war bei der Herausnahme der Geldscheine durch den Täter aus dem Geldausgabefach jedoch nicht der Fall, denn durch die ordnungsgemäße Bedienung des Automaten erfolgt die tatsächliche Ausgabe des Geldes mit dem Willen der Bank. Durch Verlassen des Geldauswurffaches liegt kein Gewahrsam der Bank mehr vor. Somit besteht kein Gewahrsamsbruch, somit fehlt es an der Wegnahme aus § 249 Abs. 1 StGB. Hier muss zwischen der reinen strafrechtlichen Gewahrsamspreisgabe durch die Bank und der gescheiterten zivilrechtlichen Übereignung differenziert werden.
Sobald der Bundesgerichtshof einen Raub ablehnt, kommt der Auffangtatbestand der räuberischen Erpressung nach §§ 253, 255 StGB in Betracht. Eine räuberische Erpressung begeht, wer rechtswidrig mit Gewalt gegen eine Person oder unter Anwendung von Drohungen mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt und dadurch dem Vermögen des Genötigten oder eines anderen Nachteil zufügt, um sich oder einen Dritten zu Unrecht zu bereichern.
Durch das Wegstoßen des Kunden ist der Gewaltbegriff erfüllt. Indem der Täter die Geldauszahlung am Automaten einleitete und die Scheine herausnahm, während der Kunde nicht eingreifen konnte, lag eine Nötigungshandlung im Sinne einer Duldung vor. Aufgrund der automatischen Belastung seines Kontos durch die Auszahlung, welche mit seiner EC-Karte durchgeführt wurde, kann auch ein Vermögensschaden eintreten, denn die begehrte Auszahlsumme habe das Opfer nie erlangt. Des Weiteren hat der Täter vorsätzlich gehandelt und sich absichtlich rechtswidrig bereichert, wonach eine Strafbarkeit nach §§ 253, 255 StGB seitens der Richter des BGH als erfüllt anzusehen war (BGH, Beschluss vom 16. November 2017 – 2 StR 154/17).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Amtsgericht Karlsruhe musste im Jahre 2013 darüber entscheiden, ob eine Strafbarkeit des Computerbetruges nach § 263 a StGB besteht, wenn man einen Geldwechselautomaten aufgrund eines Defekts zur Gewinnbringung ausnutzt.
Dem Urteil liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Geschädigte betrieb eine Spielhalle, welche mit Spielautomaten ausgestattet war, welche sowohl mit Geldscheinen als auch mit Geldmünzen bespielt werden konnten. Um den Kunden das Spielen mit kleineren Beträgen zu ermöglichen, stellte dieser einen Geldwechselautomaten auf, welcher bei Eingabe von Scheinen die Summe in Münzgeld wechselte und ausgab. Des Weiteren bestand die Funktion, mithilfe einer EC – oder Kreditkarte sich Münzgeld auszahlen zu lassen. Dadurch wurde das Konto des Auftraggebers durch das POS-System sofort mit einer Abbuchung belastet.
Dieser Automat war mit einem Defekt behaftet, welcher es den Benutzern erlaubte, Auszahlungen anzufordern, ohne dass mit der Karte verknüpfte Konto zu belasten. Diese Funktion bemerkte der Angeklagte zufälligerweise und nutzte diese im Laufe mehrerer Abende aus.
Das Amtsgericht wies eine Verurteilung auf Grundlage des § 263 a Abs. 1 StGB zurück und sprach den Angeklagten frei. Dies begründete die Richterin wie folgt:
Damit der Straftatbestand des § 263 a Abs. 1 StGB als erfüllt angesehen werden kann, müsse der Täter eine Handlung vollführen, welche einer Täuschungshandlung entspreche, falls es sich um einen Betrug gegenüber einer natürlichen Person im Sinne des § 263 Abs. 1 StGB handeln würde. Aufgrund des Defekts, welcher sich im Algorithmus des maschinenbetreibenden Programmes niederschlug, liegt durch das Ausnutzen dieses Schlupfloches gerade keine Täuschungshandlung seitens des Täters vor. Er nutze lediglich die vorhandene Funktion der Maschine, welche jedoch nicht richtig funktioniert. Vorliegend hat der Angeklagte aber gerade keinen technischen Defekt im Münzwechselautomaten „herbeigeführt“, sondern lediglich diesen genutzt, was ein gravierenden Unterschied bezüglich der Strafbarkeit darstellt, denn somit kann dem Täter keine Täuschungssituation vorgeworfen werden.
Des Weiteren führte die Richterin aus, dass auch eine Strafbarkeit wegen Unterschlagung ausscheidet. Dass Geld, welches der Automat nach der vermeintlichen Belastung der Karte auszahlte, stellt sich für den Täter jedoch nicht als fremde bewegliche Sache im Sinne des § 246 Abs. 1 StGB dar, denn der Aufsteller des Automaten hat sich für solche Fälle nicht das Eigentum am Geld vorbehalten. Solange keine Ausnahmekonstellation besteht, welche beispielsweise durch die Regelung anhand von Allgemeinen Geschäftsbedingungen geschaffen werden kann, liegt eine wirksame Übereignung an den Täter vor, da er den Automaten ja rechtmäßig bedient und selbst keine Manipulation der Maschine vornimmt.
Mithin konnte der Täter die Auszahlungsfunktion des Münzwechslers mehrfach nutzen, ohne strafrechtliche Konsequenzen zu fürchten (AG Karlsruhe, Urteil vom 22.07.2013 – 15 Ds 341 Js 11203 / 11).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Anfang 2019 hatten die Richter aus Karlsruhe einen Revisionsfall des Waffenverkäufers zu entscheiden, welcher den tragischen Amoklauf des David S. am 22. Juli 2016 in München ermöglichte.
Dem Beschluss liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte Waffenverkäufer musste sich vor dem Landgericht München verantworten, welches den Betroffenen aufgrund mehrerer Waffendelikte, im Fall des Amoklaufes sogar in Tateinheit mit einer fahrlässigen Tötung in neun Fällen sowie einer fahrlässigen Körperverletzung in fünf Fällen, zu einer Gesamthaftstrafe von 7 Jahren verurteilte.
Um seine Anonymität zu gewährleisten, nutzte der Angeklagte Handelsplätze im sogenannten „Darknet“, auf welchen Kriminelle gesetzlich verbotene Waren zum Kauf und Verkauf anbieten. Er kommunizierte mit den Käufern über einen verschlüsselten Bitmessage-Dienst. Obwohl es üblich ist, dass solch kriminell-brisanten Waren anonym auf dem Postweg versendet werden, hat der angeklagten Waffenverkäufer seine Übergaben stets während eines persönlichen Treffens stattfinden lassen, so auch am 20. Mai 2016, als er David S eine Pistole des Typs „Glock-17“ sowie 567 Patronen verkaufte, welche als Tatwaffe des Münchner Amokläufers diente.
Gegen dieses Urteil richtet sich der Angeklagte mit einer Revision zum Bundesgerichtshof und fordert v.a. eine Überprüfung der Fahrlässigkeitsstrafbarkeit.
Laut den Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichts hatte David S. niemanden in die Planung seines Vorhabens einbezogen, sondern handelte selbstständig und allein. Selbst der Angeklagte wusste nichts von den Plänen des David S, mit den soeben erworbenen Waffen einen erschreckenden Amoklauf im Münchner Olympiaeinkaufszentrum vorzubereiten. Bei den Verhandlungen über die Waffe habe sich dieser noch als junger Waffensammler ausgegeben, welcher lediglich ein Interesse an der Technik solcher Pistolen hegt.
Demnach lehnte das LG München die Verurteilung aufgrund Beihilfe zum Mord sowie Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung wegen mangelnden Vorsatzes ab. Die Strafbarkeit der Beihilfe fußt auf dem „Akzessioritätsprinzip“, demnach ist ein sogenannter „doppelter Beihilfevorsatz“ erforderlich, einmal hinsichtlich der vorsätzlichen, rechtswidrigen Haupttat, andererseits hinsichtlich der eigenen Unterstützungshandlung. Da es der Waffenverkäufer jedoch in keinem Fall für möglich hielt, dass der 18-jährige David S. eines Amoklaufs fähig ist, so habe er auch nicht hinsichtlich der gleichen Unrechts – und Angriffsrichtung wie dieser gehandelt, was einen Eventualvorsatz und somit eine Beihilfestrafbarkeit ausschließt.
Dennoch ist die Verurteilung zur fahrlässigen Tötung, § 222 StGB in neun Fällen und fahrlässigen Körperverletzung, § 229 StGB in fünf Fällen seitens des Bundesgerichtshofes rechtlich nicht zu beanstanden.
Die Sorgfaltspflichtsverletzung, welche zur Annahme einer Fahrlässigkeit führt, stellt hier der illegale Verkauf von Schusswaffen und Munition dar, was bereits an sich den Straftatbestand des § 52 Abs.1 Nr. 2 lit. c WaffG erfüllt. Erschwerend kommt hinzu, dass aufgrund der Anbahnung der Vertragsverhandlungen im „Darknet“ keine zuverlässige Kontrolle des Käufers der Waffe möglich ist, da auch dieser seine wirkliche Identität verschleiert und anonym agiert. Dass der Kauf einer funktionsfähigen Waffe es David S. ermöglicht, eine Anzahl von Menschen zu töten, ist sowohl objektiv als auch subjektiv für den Waffenverkäufer „vorhersehbar“ und nicht außerhalb der allgemeinen Lebenserfahrung angesiedelt, womit eine Fahrlässigkeitsstrafbarkeit zu bejahen war.
Demnach verwirft der BGH die eingelegten Rechtsmittel als unbegründet, wodurch das Verfahren rechtskräftig abgeschlossen wurde (BGH, Beschluss vom 08.01.2019 – 1 StR 356/18).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Brandaktuell hat sich der BGH am 18.06.2020 mit der zweiten Revisionsentscheidung bezüglich des Ku´damm Raser-Falles zu Wort gemeldet. Der für Verkehrsstrafsachen zuständige IV. Strafsenat des Bundesgerichtshofs hat nun über den zweiten Rechtsgang des Landgerichts Berlin entschieden und das Urteil teilweise an das Strafgericht zur Neuverhandlung zurückverwiesen.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt in Kürze zugrunde:
Die beiden Angeklagten lieferten sich am 01.02.2016 auf dem Berliner Kurfürstendamm ein Autorennen, wobei die Beiden auf solche Geschwindigkeiten beschleunigten, dass einer der beiden Teilnehmer aufgrund der rechtmäßigen Vorfahrt eines Straßenverkehrsteilnehmers nicht mehr rechtzeitig bremsen und ausweichen konnte und es zu einer Kollision kam, bei der der Unbeteiligte ums Leben kam.
Das Landgericht Berlin hatte die beiden Angeklagten im ersten Rechtsgang spektakulär aufgrund eines mittäterschaftlich begangenen Mordes nach § 211 Abs. 2, 25 Abs. 2 StGB zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Die Besonderheit des Falles lag v.a. in der Annahme eines Tötungsvorsatzes in Form einer Billigung der Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer aufgrund der Rücksichtslosigkeit der Rennhandlung. Gegen dieses Urteil wurde zum ersten Mal Revision eingelegt, welche den Fall zum Bundesgerichtshof führte. Die Richter in Karlsruhe hoben das erste Urteil auf und haben die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung an das Landgericht Berlin zurückverwiesen.
Im zweiten Rechtsgang hat das Landgericht Berlin die beiden Angeklagten nunmehr erneut unter anderem wegen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Auch dagegen wandten sich die Angeklagten mit einer erneuten Revision zum Bundesgerichtshof.
Die Revision des am Unfall unmittelbar beteiligten Angeklagten hat der Senat verworfen, den Schuldspruch wegen Mordes bestätigt und lediglich eine Schuldspruchkorrektur vorgenommen. In der Begründung gehen die Richter erneut auf die billigende Inkaufnahme eines schweren Verkehrsunfalles mit tödlichen Folgen für den Unfallgegner ein und kommen zu dem Ergebnis, dass die Feststellung des bedingt vorsätzlichen Handelns durch das Landgericht keinerlei Rüge bedarf. Die Tatrichter haben die Umstände außerordentlich sorgfältig abgewogen und etwaige Besonderheiten des atypischen Falles ausreichend gewichtet und begründet. Lediglich die Ausführungen zum Mordmerkmal der Tötung mit einem „gemeingefährlichen Mittel“ weisen Rechtsfehler auf. Diese wirke sich jedoch nicht auf den Strafausspruch aus, da weitere Mordmerkmale der Heimtücke sowie der Tötung aus niederen Beweggründen hinreichend gewürdigt und erfüllt wurden. Das Urteil gegen den unmittlebar mit dem verstorbenen Unfallgegner kollidierenden Angeklagten ist somit rechtskräftig.
Hinsichtlich des Mitangeklagten, wessen Fahrzeug nicht mit dem des Unfallopfers kollidierte, hat der Senat das Urteil insgesamt aufgehoben. Nach Aussage der Richter konnte die Verurteilung wegen mittäterschaftlich begangenen Mordes konnte keinen Bestand haben, weil die Beweiswürdigung des Landgerichts die Feststellung eines gemeinsamen, auf die Tötung eines Menschen gerichteten Tatentschlusses nicht vollständig trägt. Das Landgericht habe sich zwar ausführlich mit dem Vorsatz des kollidierten Fahrers auseinandergesetzt, jedoch keine ausreichende Würdigung des Vorsatzes des Mitangeklagten an den Tag gelegt. Es mangelt somit an der mittäterschaftlichen Zurechnung der Tat des Unfallverursachers. Das Landgericht führt in seinem Urteil zwar aus, dass das Zufahren auf die Kreuzung durch das Straßenrennen einen Tatplan beinhalte, welcher konkludent auf die gemeinsame Tötung eines anderen Menschen ausgeweitet werden könne, begründet diese Annahme jedoch nicht in voller Sorgfalt. Laut BGH liege diese Annahme jedoch fern, da der Mitangeklagte sich nach den bisherigen Feststellungen lediglich auf das Rennen fokussierte. Ein Eventualvorsatz könnte auch in diesem Fall angenommen werden, bedarf jedoch einer tiefergehenden Begründung.
Somit hat das Landgericht Berlin nun zum dritten Mal das Ruder in den Händen, was den Raser-Fall jetzt schon zu einem der spektakulärsten Strafprozesse der Bundesrepublik macht. Möglicherweise hat auch der Bundesgerichtshof in Karlsruhe bei der dritten Runde die Chance, ein Wörtchen mitzureden. Es bleibt spannend (BGH 4 StR 482/19 – Urteil vom 18. Juni 2020).
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht