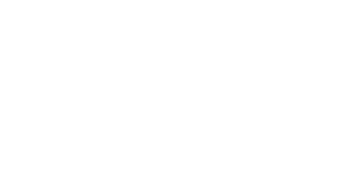Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht
Die 5. Strafkammer des Bundesgerichtshofs hat in einem Urteil vom Sommer 2015 darauf aufmerksam gemacht, dass der Verkauf von deutlich überteuerten Eigentumswohnungen, deren Wert deutlich unter dem des Kaufpreises lag, nicht zwingend eine Strafbarkeit des Betruges nach § 263 Abs. 1 StGB mit sich zieht.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die Staatsanwaltschaft wurde auf einem Immobilienverkäufer aufmerksam, welcher aufgrund einer anonymen Anzeige wohl minderwertige Eigentumswohnungen zu extrem erhöhten Preisen an unerfahrene Privatpersonen verkauft haben soll, um dadurch an erhöhte Provisionszahlungen zu gelangen.
Das Landgericht Berlin verneinten die Strafbarkeit wegen Betruges gemäß § 263 StGB, denn aus Sicht der Richter habe nicht ausreichend festgestellt werden können, dass die Käufer der angebotenen Immobilien letztendlich auch über deren Werthaltigkeit gezielt seitens des Verkäufers getäuscht worden sind. Es sei im Interessenkreis des Käufers, sich über den Zustand des Wohnobjektes sowie den üblichen Wert der Sache selbst ausreichend zu informieren. Wird ein Kaufpreis gefordert und vertraglich vereinbart, so erkläre damit der Verkäufer nicht automatisch, dass das Kaufobjekt den Kaufpreis auch wert sei. Im Zivilrecht besteht die Möglichkeit, sowohl „gute“ als auch „schlechte“ Geschäfte abzuschließen, in welchen sich der Kaufpreis vom wirklichen Wert der Sache unterscheidet.
Diese Entscheidung erging nicht zur Zufriedenheit der Staatsanwaltschaft, welche Revision gegen das landgerichtliche Urteil zum Bundesgerichtshof einlegte.
Die Richter aus Karlsruhe bestätigten die Entscheidung der Vorinstanz und wiesen demnach die Revision der Staatsanwaltschaft zurück. Mit Rücksicht auf das Prinzip der Vertragsfreiheit sei grundsätzlich wenig Raum für die Annahme konkludenter Erklärungen über die Angemessenheit oder Üblichkeit eines objektiven Preises; es sei vielmehr Sache des Käufers, abzuwägen und selbst zu entscheiden, ob er die vertraglich vereinbarte Vergütung dafür aufwenden möchte.
Seitens des Verkäufers besteht eine Handlungsfreiheit bis zur Grenze der Sittenwidrigkeit oder des Wuchers, welche in § 138 BGB geregelt sind und die Nichtigkeit des Vertrages mit sich bringen würden. Ist eine solche Grenze noch nicht erreicht, wie sich auch nach den Feststellungen des Landgerichts zeigt, so besteht seitens des Verkäufers auch keine Pflicht zur Offenlegung des Wertes des Kaufobjekts, auch wenn dies erheblich unter dem geforderten Preis liegt.
Es sei nicht Aufgabe des Verkäufers, den Käufer vor ungünstigen Geschäften zu warnen oder auf diese hinzuweisen. Nach allgemeiner Lebenserfahrung darf davon ausgegangen werden, dass sich ein künftiger Vertragspartner im eigenen Interesse selbst über Art und Umfang seiner Vertragspflichten einen Überblick verschafft hat.
BGH, Urteil vom 20.05.2015 – 5 StR 547/14 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Amtsgericht München musste sich im Frühjahr 2015 erneut mit den rechtlichen Tiefen der Beleidigungsdelikte auseinandersetzen. Die Tatrichterin entschied, dass der Schriftzug „FCK CPS“ auf einem Jutebeutel ausreicht, um die Beleidigung eines Polizeibeamten anzunehmen. Die 19-jährige Täterin wurde demnach zu einer Arbeitsauflage von 32 gemeinnützigen Arbeitsstunden verurteilt.
Dem Fall liegt folgender konkreter Sachverhalt zugrunde:
Eine Studentin nahm im September 2015 an einer Kundgebung in der Münchner Innenstadt teil. Dabei trug Sie eine schwarze Umhängetasche, auf welcher in großen Buchstaben die Aufschrift „FCK CPS“ zu sehen war, wodurch Sie ihre Missachtung gegenüber der deutschen Polizei ausdrücken wollte. Die Beschuldigte hielt die Tasche für die Umgebung gut sichtbar in den Händen, so dass auch ein bei der Versammlung eingesetzter Polizeibeamter den Schriftzug erkannte und diesbezüglich wahrnahm.
Daraufhin wurde die junge Frau von diesem Beamten angesprochen, welcher ihr erklärte, dass der Schriftzug eine Beleidigung für ihn darstelle. Er forderte Sie auf, die Tasche mit dem sichtbaren Schriftzug zu verdecken, ansonsten drohe er mit einer Anzeige, falls er den Schriftzug noch einmal offen sichtbar während der Versammlung entdecken würde. Folglich wurde der Schriftzug seitens der Dame mit einer Jacke bedeckt. Im weiteren Verlauf des Nachmittags hat die Studentin die Jacke jedoch angezogen und demnach den Schriftzug erneut entblößt, weshalb es zu einem Strafantrag seitens der Polizeibeamten und dessen Dienstvorgesetzten aufgrund einer Beleidigungsstraftat nach § 185 StGB gekommen ist.
Während der Verhandlung vor dem Amtsgericht München verwies die 19-Jährige vermehrt auf einen Beschluss des Oberlandesgerichts Nürnberg, welcher klar mache, dass das Tragen einer Tasche mit einer solchen Aufschrift nicht strafbar sei. Dennoch räumte die Studentin vollständig ein, die Tasche getragen zu haben und auch von dem Polizeibeamten auf ihr strafbares Verhalten hingewiesen worden zu sein.
Die Abweichung zum oberlandesgerichtlichen Beschluss aus Nürnberg sah die Tatrichterin mit der konkreten Konfrontation gegenüber des einen Polizeibeamten, welcher das Tragen der Tasche bereits während der Versammlung monierte. Der Aufdruck auf der Tasche sei nach dem Wortsinn einer Beleidigung gleichzustellen. Aufgrund der direkten Konfrontation richtet sich der Schriftzug und dessen Bedeutung demnach auch gegen konkret eingesetzte Personen, nämlich die unmittelbar damit verbundenen Polizeibeamten, welche die Tasche erkannten und die Studentin auf ihr Verhalten hinwiesen. Der jungen Frau hätte es spätestens bewusst werden müssen, dass sie sich auf strafrechtlichem Grund bewege, als sie von den Polizeibeamten aufgrund ihrer Tasche angesprochen wurde, v.a. als die Androhung einer Strafanzeige ins Gespräch kam.
Die Richterin sah durch dieses Verhalten den Straftatbestand erfüllt und verurteilte die Studentin zu einer Ableistung von 32 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Bei der Höhe der Ahnung hat das Gericht berücksichtigt, dass die Studentin bereits einmal wegen des Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz auffällig geworden ist. Schwer wiegt zudem die Tatsache, dass die Tasche bei einer Demonstration in Anwesenheit von Demonstranten und Gegendemonstranten getragen wurde und damit ein Konfliktpotential in sich trug. Die bewusste Diffamierung der zum Schutz der Demonstrationsteilnehmer aufgestellten Polizeibeamten sei in dieser Situation als besonders verwerflich zu bewerten, entschied das Gericht.
Amtsgericht München, Urteil vom 13.04.2015
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe musste sich im Sommer 2016 mit der Reichweite der Beleidigungsdelikte nach § 185 ff. StGB befassen und dessen verfassungsrechtliche Grenzen konkretisieren. Die Richter kamen zu dem Entschluss, dass eine Beleidigung nach dem Strafgesetzbuch erst dann gegeben ist, wenn die Äußerung sich auf eine hinreichend überschaubare und abgegrenzte Personengruppe bezieht.
Dies führe zu einer ausreichenden Abwägung zwischen der Freiheit der Meinungsäußerung nach Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG und dem Schutz der eigenen Ehre, welcher seinen Ausdruck im allgemeinen Persönlichkeitsrecht aus Art. 2 Abs. 1 sowie Art. 1 Abs. 1 GG widerspiegelt.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der spätere Beschwerdeführer trug zu einem Besuch seines heimischen Fußballvereines eine schwarze Hose, welche im Gesäßbereich großflächig mit dem Schriftzug „ACAB“ bedruckt war, was als Abkürzung für „All Cops Are Bastards“ bekannt ist. Nach dem Spiel verließ er das Stadion und passierte einen eingesetzten Trupp der Bereitschaftspolizei, welche zur Sicherung des Fußballspieles bestimmte Bereiche absicherte. Die Polizeibeamten sahen sich darin in ihrer Ehre diskreditiert und stellten eine Strafanzeige aufgrund der Erfüllung eines Beleidigungstatbestandes nach § 185 StGB.
Das erstinstanzlich zuständige Amtsgericht verurteilte den Beschwerdeführer aufgrund einer Beleidigungstat. Die Berufung zum Landgericht als auch zum Oberlandesgericht blieben erfolglos.
Als letzte Möglichkeit nach Erschöpfung des ordentlichen Rechtsweges legt der Beschwerdeführer eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe ein und rügt die Verletzung des Grundrechts der Meinungsfreiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG durch die letzten justiziellen Urteile.
Der Beschwerdeführer trägt vor, dass die Parole „ACAB“ nicht von vornherein offensichtlich inhaltslos sei, sondern eine allgemeine Ablehnung gegenüber der Polizei und der staatlichen Ordnungsmacht ausdrücke, was unter die Definition der Meinungsäußerung fällt und demnach den Schutzbereich des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 GG eröffnet. Die Urteile gegen den Beschuldigten stellen zudem einen Eingriff dar. Obwohl die Auslegung und Anwendung der Strafgesetze im Grundsatz den Fachgerichten überlassen wird, müssen auch diese bei Verurteilungen die verfassungsrechtliche Würdigung des § 185 StGB als Schranke der freien Meinungsäußerung bewahren. Damit diese Schranke jedoch angewendet werden kann, ist eine hinreichende Individualisierung des negativen Werturteiles notwendig.
Das Bundesverfassungsgericht folgt vorliegend der Argumentation des Beschwerdeführers und gibt der Verfassungsbeschwerde letztendlich statt. Eine herabsetzende Äußerung, die weder bestimmte Personen benennt noch erkennbar auf bestimmte Personen bezogen ist, sondern ohne individuelle Aufschlüsselung ein Kollektiv erfasst, kann zwar unter bestimmten Umständen ein Angriff auf die persönliche Ehre der Mitglieder des Kollektivs sein.
Je größer das Kollektiv ist, auf das sich die herabsetzende Äußerung bezieht, desto schwächer kann auch die persönliche Betroffenheit des einzelnen Mitglieds werden, weil es bei den Vorwürfen an große Kollektive meist nicht um das individuelle Fehlverhalten oder individuelle Merkmale der Mitglieder, sondern um den aus der Sicht des Sprechers bestehenden Unwert des Kollektivs und seiner sozialen Funktion sowie der damit verbundenen Verhaltensanforderungen an die Mitglieder geht.
Dabei kann es verfassungsrechtlich nicht zulässig sein, die Äußerung als auf eine hinreichend überschaubare Personengruppe zu behandeln, nur weil diese Gruppe von Polizisten im Einzelfall eine Art „Teilgruppe“ der allgemeineren Gattung der Polizei darstellt und demnach den bezeichneten Personenkreis bildet.
Nach den Richtern aus Karlsruhe käme es nicht darauf an, dass die Polizeikräfte die Parole „ACAB“ überhaupt als Teilgruppe aller Polizeibeamter auf der Welt wahrnehmen. Es bedarf vielmehr einer personalisierten Adressierung dieser Parole, was im vorliegenden Fall jedoch nicht ersichtlich ist. Das alleinige kognitive Merkmal des Wissens seitens des Beschwerdeführers, dass sich die Polizei im und in der Nähe des Fußballspieles aufhält, reicht nicht aus, um ein solches Individualisierungswissen aufzubringen. Zudem gäbe es keine gesonderten Feststellungen dazu, dass sich der Beschwerdeführer gezielt in die Nähe der Einsatzkräfte begab, um diese dort mit der getragenen Parole zu konfrontieren.
Demnach wurde die Schranke des § 185 StGB seitens der Fachgerichte nicht verfassungskonform angewandt. Das Bundesverfassungsgericht hat verfassungsrechtliche Fehler festgestellt und demnach die Entscheidungen der ordentlichen Gerichtsbarkeit aufgehoben und zur Neuverhandlung angesetzt.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 17.05.2016 – 1 BvR 257/14, 1 BvR 2150/14 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Foto: AdobeStock Nr.: 259424902 MKS
Der Strafsenat des Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 10.06.2015 klargestellt, dass eine rechtstaatswidrige Provokation einer Straftat durch verdeckte Ermittler ein Verfahrenshindernis begründet. Komme es nur deswegen zu einer Strafbarkeit wegen Beihilfe, weil die Ermittler die Tat durch massives Drängen provozieren, so darf es zu keiner Verurteilung wegen Beihilfe führen.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Aufgrund eines Anfangsverdachtes in Bezug auf weitreichende Drogendelikte wurde gegen den einschlägig vorbestraften Eigentümer einer Bar im Winter 2010 eine verdeckte Ermittlung durch sogenannte „V-Männer“ angeordnet. Diese V-Männer haben daraufhin im Januar 2011 damit begonnen, Kontakt zum Barbesitzer aufzunehmen und das Vertrauen von ihm zu gewinnen. Nachdem dies gelungen ist, drängten die verdeckten Ermittler im April 2011 den Barbesitzer massiv zur Vermittlung von Drogenlieferanten.
Nachdem der Observierte Verdacht schöpft, wehrt er jegliche Forderung mit der Begründung ab, dass er „mit solchen Dingen nichts zu tun haben möchte“ und sein Geld lieber auf legalem Wege durch das Betreiben der Bar verdiene. Damit gaben sich die Ermittler jedoch nicht zufrieden und bedrängten den Besitzer erneut zur Vermittlung von Kontakten in das Drogenmilieu. Diesmal nutzten Sie einen Vorwand, dass bei Nichtpreisgabe der Informationen seine engeren Verwandten durch serbische Kriminelle bedroht und verletzt werden „könnten“. Aufgrund dieser aufgebauten Drucksituation hat der Barbesitzer die Kontakte preisgegeben, um sich, seine Familie sowie seine Freunde zu schützen. In der Folgezeit haben die Ermittler Kontakt mit den Drogenkurieren aufgenommen, wodurch es zum Verkauf der Drogen kam. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft den Barbesitzer aufgrund der Informationspreisgabe unter Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmittel angeklagt.
Das erstinstanzliche Landgericht Bonn hat den Angeklagten aufgrund der Beihilfe verurteilt. Dabei wurde bereits strafmildernd berücksichtigt, dass der Anstoß für das Drogengeschäft nicht auf der autonomen Entscheidung des Barbesitzers beruhte, sondern seitens der beiden V-Männer ausging. Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des Angeklagten, welche in Karlsruhe vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wurde.
Die Richter aus Karlsruhe entscheiden zu Gunsten des Angeklagten und hoben die Entscheidung des Landgerichts auf. Es liege nach Ansicht der Bundesrichter eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation aufgrund der Drohungshandlung seitens der Ermittler vor, welche nicht mit dem Grundsatz des fairen Verfahrens aus Art. 6 Abs 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie dem grundrechtlich festgelegten Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG zu vereinbaren ist. Die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden sei allein die Aufklärung von Straftaten, jedoch nicht deren unmittelbare Herbeiführung, wie es im obig geschilderten Fall eingetreten ist.
Der Einsatz der verdeckten Ermittler habe sich nicht weitgehend auf die passive Strafermittlung beschränkt, sondern stellte eine massive Einwirkung auf den Angeklagten dar, welcher aufgrund dieses Verhaltens erst davon geprägt und bestimmt wurde, den verdeckten Ermittlern „einen Gefallen zu tun“.
Da das Rechtsstaatsprinzip eine tragende Säule der Staatsziele der Bundesrepublik Deutschlands darstelle, könne ein solches Verhalten seitens der Ermittler nicht vertreten werden. Deshalb begründe eine solche Handlung ein Verfahrenshindernis, welches die Verurteilung des Angeklagten unmöglich mache. Die mildere Form der Strafzumessung im Sinne einer Strafmilderung komme nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 23.10.2014 (AZ.: 54648/09) nicht mehr in Betracht.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.06.2015 – 2 StR 97/14 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Strafsenat des Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil vom 10.06.2015 klargestellt, dass eine rechtsstaatswidrige Provokation einer Straftat durch verdeckte Ermittler ein Verfahrenshindernis begründet. Komme es nur deswegen zu einer Strafbarkeit wegen Beihilfe, weil die Ermittler die Tat durch massives Drängen provozieren, so darf es zu keiner Verurteilung wegen Beihilfe führen.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Aufgrund eines Anfangsverdachtes in Bezug auf weitreichende Drogendelikte wurde gegen den einschlägig vorbestraften Eigentümer einer Bar im Winter 2010 eine verdeckte Ermittlung durch sogenannte „V-Männer“ angeordnet. Diese V-Männer haben daraufhin im Januar 2011 damit begonnen, Kontakt zum Barbesitzer aufzunehmen und das Vertrauen dessen zu gewinnen. Nachdem dies gelungen ist, drängten die verdeckten Ermittler im April 2011 den Barbesitzer massiv zur Vermittlung von Drogenlieferanten.
Nachdem der Observierte Verdacht schöpft, wehrt er jegliche Forderung mit der Begründung ab, dass er „mit solchen Dingen nichts zu tun haben möchte“ und sein Geld lieber auf legalem Wege durch das Betreiben der Bar verdiene. Damit gaben sich die Ermittler jedoch nicht zufrieden und bedrängten den Besitzer erneut zur Vermittlung von Kontakten in das Drogenmilieu. Diesmal nutzten Sie einen Vorwand, dass bei Nichtpreisgabe der Informationen seine engeren Verwandten durch serbische Kriminelle bedroht und verletzt werden „könnten“. Aufgrund dieser aufgebauten Drucksituation hat der Barbesitzer die Kontakte preisgegeben, um sich, seine Familie sowie seine Freunde zu schützen. In der Folgezeit haben die Ermittler Kontakt mit den Drogenkurieren aufgenommen, wodurch es zum Verkauf der Drogen kam. Daraufhin hat die Staatsanwaltschaft den Barbesitzer aufgrund der Informationspreisgabe unter Beihilfe zum Handeltreiben mit Betäubungsmittel angeklagt.
Das erstinstanzliche Landgericht Bonn hat den Angeklagten aufgrund der Beihilfe verurteilt. Dabei wurde bereits strafmildernd berücksichtigt, dass der Anstoß für das Drogengeschäft nicht auf der autonomen Entscheidung des Barbesitzers beruhte, sondern seitens der beiden V-Männer ausging. Gegen dieses Urteil richtet sich die Revision des Angeklagten, welche in Karlsruhe vor dem Bundesgerichtshof verhandelt wurde.
Die Richter aus Karlsruhe entscheiden zu Gunsten des Angeklagten und hoben die Entscheidung des Landgerichts auf. Es liege nach Ansicht der Bundesrichter eine rechtsstaatswidrige Tatprovokation aufgrund der Drohungshandlung seitens der Ermittler vor, welche nicht mit dem Grundsatz des fairen Verfahrens aus Art. 6 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention sowie dem grundrechtlich festgelegten Rechtsstaatsprinzip aus Art. 20 Abs. 3 GG zu vereinbaren ist. Die Aufgabe der Strafverfolgungsbehörden sei allein die Aufklärung von Straftaten, jedoch nicht deren unmittelbare Herbeiführung, wie es im obig geschilderten Fall eingetreten ist.
Der Einsatz der verdeckten Ermittler habe sich nicht weitgehend auf die passive Strafermittlung beschränkt, sondern stellte eine massive Einwirkung auf den Angeklagten dar, welcher aufgrund dieses Verhaltens erst davon geprägt und bestimmt wurde, den verdeckten Ermittlern „einen Gefallen zu tun“.
Da das Rechtsstaatsprinzip eine tragende Säule der Staatsziele der Bundesrepublik Deutschlands darstelle, könne ein solches Verhalten seitens der Ermittler nicht vertreten werden. Deshalb begründe eine solche Handlung ein Verfahrenshindernis, welches die Verurteilung des Angeklagten unmöglich mache. Die mildere Form der Strafzumessung im Sinne einer Strafmilderung komme nach der Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte vom 23.10.2014 (AZ.: 54648/09) nicht mehr in Betracht.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 10.06.2015 – 2 StR 97/14 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Der Bundesgerichtshof hat sich in seinem Urteil vom Januar 2019 erneut mit dem speziellen rechtlichen Problem der sogenannten „Notwehrprovokation“ beschäftigen müssen, welche in bestimmten Fällen das allseits bekannte Notwehrrecht einschränken oder sogar komplett entfallen lassen kann.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um folgenden Sachverhalt, über wessen die Richter aus Karlsruhe entscheiden mussten:
An einem Abend im September 2017 urinierte eine alkoholisierte Frau heimlich in einem Wartehäuschen eines Bahnhofs. Als ein Passant zufälligerweise an dieser vorbeiging, beanstandete er die Handlung, wodurch es zu einem ausgedehnten und erregten Streitgespräch zwischen dem Lebensgefährten der Frau und dem Passanten kam. Als sich die Situation verbal zuspitzte, zog der Lebensgefährte der alkoholisierten Frau unbemerkt ein 7cm langes klappbares Jagdmesser, welches er in seiner Tasche mit sich führte und zeigte dies provokant in Richtung des Beschwerers.
Durch dieses Verhalten fühlte sich der Passant derart herausgefordert, dass dieser zu einem Schlag ansetzt. Um diesen rechtswidrigen, gegenwärtigen Angriff abzuwehren, stieß der Lebensgefährte dem anderen Mann das Messer in die linke Körperflanke. Dadurch kam es zu einer schweren inneren Blutung sowie einer Organverletzung.
Der Sachverhalt wurde erstinstanzlich vor dem Landgericht Dortmund verhandelt. Die Richter sahen den Messerstich problemlos durch das Notwehrrecht nach § 32 StGB gerechtfertigt. Der Angeklagte wurde demnach freigesprochen.
Gegen diese Entscheidung richtet sich die Revision der Staatsanwaltschaft, welche den Fall nach Karlsruhe führte.
Die Bundesrichter bemängelten, dass das Landgericht nicht ausreichend geprüft habe, ob der Beschuldigte den Schlagangriff des Passanten möglicherweise provoziert habe und demnach die Einschränkung seines Notwehrrechtes nach § 32 StGB in Betracht käme. Zudem wären die vorhanden Indizien für diese Prüfung ausreichend gegeben, denn nach den Feststellungen des Landgerichtes habe der Lebensgefährte sein Vorverhalten derart ausgeführt, dass er sogar vor dem Passanten herumsprang und diverse Kampfgeräusche von sich gab. Des Weiteren könne nicht nur diese Handlung bereits eine einschränkende Notwehrprovokation darstellen, sondern seitens der Richter bereits die vorherige verbale Auseinandersetzung ausreichen, um in dieser angespannten und aufgeheizten Situation den Angriff des Passanten herauszufordern und so eine Notwehrprovokation anzunehmen.
Unter den festgestellten Umständen könne auch nicht ausgeschlossen werden, dass der Lebensgefährte den Passanten sogar gezielt provozieren wollte, um sich unter dem Deckmantel des Notwehrrechtes an diesem zu vergreifen und so schadlos davon zu kommen. Dies gelte insbesondere in Anbetracht dessen, dass der Beschuldigte in dieser Situation unbemerkt ein Messer zog und es gegen den Passanten richtete.
Die Frage der Notwehrprovokation stehe somit offensichtlich im Raum und müsse daher ausgiebig seitens der Strafkammer des Landgerichts erörtert werden.
Da dieses zu dieser Problematik jedoch keinerlei Ausführungen machte, wies der Bundesgerichtshof den Fall zur Neuverhandlung an das Landgericht zurück.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 17.01.2019 – 4 StR 456/18 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
In einem brandneuen Beschluss aus dem August 2020 wurde die Rechtsproblematik des „Containers“ nun auch vom höchsten Gericht Deutschlands geklärt und als strafrechtlich relevant empfunden. Dies hat zur Konsequenz, dass die Entnahme von Lebensmitteln aus dem Abfallbehälter eines Supermarktes nach aktuellem Recht als Diebstahl nach § 242 Abs. 1 StGB bestraft werden kann. Die Karlsruher Verfassungsrichter deuteten darauf hin, dass den vorliegenden Verurteilen keine rechtlichen Fehler anhaften. Letztendlich liegt es beim Gesetzgeber, eine Entkriminalisierung eines solchen Verhaltens herbeizuführen.
Ausschlaggebend war folgender Fall:
Die beiden Beschwerdeführerinnen entwendeten zahlreiche Lebensmittel aus einem verschlossenen Abfallcontainer, welcher sich auf dem Parkplatz eines Supermarktes befand und dort für die entgeltliche Abholung durch einen Abfallentsorger bereitgestellt wurde. In dem Container befanden sich Lebensmittel, welche die Grenze der Mindesthaltbarkeit bereits überschritten haben oder aufgrund ihres Erscheinungsbildes nicht mehr verkauft werden konnten.
Das erstinstanzliche Amtsgericht sah in dieser Handlung eine gezielte Wegnahme von fremden beweglichen Sachen, welche keiner „Derelektion“ (Eigentumsaufgabe) nach § 959 BGB unterlagen und somit für die beiden Studentinnen immer noch „fremd“ waren. Nach ausführlicher Beweiswürdigung kam der Tatrichter zu dem Entschluss, dass durch den Verschluss des Containers sowie den gezielten Entsorgungsvertrag mit dem Abfallentsorger eine solche Eigentumsaufgabe nicht im Sinne des Supermarktes stand. Die beiden Angeklagten wurden aufgrund eines Diebstahles nach § 242 Abs. 1 StGB verurteilt.
Dagegen wehrten diese sich mit einer Sprungrevision zum Bayerischen Obersten Landesgericht, welches diese jedoch als unbegründet verwarf. Die Auffassung des Amtsgerichts, die Lebensmittel seien fremd gewesen, begegne keinen rechtlichen Bedenken. Auch die Argumentation der Wertlosigkeit der Sache wurde von den Richtern ausgehebelt, welche durch diesen Umstand keine berechtigte Wegnahme durch Dritte erkannten.
Letztendlich erhoben die beiden Beschwerdeführerinnen Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe und rügten die Verletzung ihres allgemeinen Persönlichkeitsrechtes aus Art. 2 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG sowie eine Verletzung ihrer allgemeinen Handlungsfreiheit aus Art. 2 Abs. 1 GG. Diese Verletzungen leiten sich aus dem Verstoß gegen das „Übermaßverbot“ her, denn die weggeworfenen Lebensmitteln seien nicht von solch einem schutzwürdigen Interesse, dass diese im Sinne des „ultima-ratio-Gedankens“ des Strafrechtes durchgesetzt werden können. Außerdem sei Art. 20 a GG zu beachten, welcher auch den Gemeinwohlbelang eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Umganges mit Lebensmitteln beinhalte, welche durch die Verurteilung wohl konterkariert werde.
Das Bundesverfassungsgericht gibt den Verfassungsbeschwerden jedoch nicht statt.
Einerseits sei dazu aus strafrechtlicher Sicht kein Grund ersichtlich, denn die richterliche Beweiswürdigung enthalte keine verfassungsrechtlichen Fehler, welche hier rügefähig wären. Die Fachgerichte haben maßgeblich auf eine ausreichende Tatsachenfeststellung sowie auch die Begründung der Ablehnung der vermeintlichen „Derelektion“ Rücksicht genommen. Dies sei ausreichend und unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten vollumfänglich möglich.
Andererseits verstoße das sogenannte „Containern“ auch nicht gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit sowie des „Ultima-Ratio-Prinzips“. Kommt es zu solchen Einzelfällen, so ist es grundsätzlich Sache des Gesetzgebers, den Bereich der strafbaren Handlung verbindlich für alle Bürger festzulegen. Ob der Gesetzgeber seinerseits die zweckmäßigste, vernünftigste oder gerechteste Lösung gefunden habe, liegt nicht im Prüfungsrahmen des Bundesverfassungsgerichtes. Dieses wacht lediglich darüber, ob die materielle Strafvorschrift im Einklang mit der Verfassung steht, was vorliegend der Fall ist.
Solange der Gesetzgeber demnach nicht tätig wurde und in besonderen Fällen den Eigentumsschutz aus Art. 14 Abs. 1 GG mit besonderen Inhalts – und Schrankenbestimmungen belegt, so ist an einer Verurteilung bezüglich des „Containerns“ nichts auszusetzen.
Zum Schutze der Angeklagten bestehe seitens des Straf – und Strafprozessrechtes hinreichende Möglichkeiten, eine ausgewogene Einzelfallentscheidung zu fällen, auch unter Nutzung etwaiger Strafmilderungsvorschriften.
Letztendlich wurde durch diesen Beschluss ein deutliches Signal aus Karlsruhe gesendet, dass es in besonderen Fällen Aufgabe der Legislative /des Gesetzgbers ist, bestimmtes strafrechtliches Verhalten aus dem Strafkatalog zu entfernen und eine richterliche Rechtsfortbildung im vorliegenden Fall nicht in Betracht kommt.
Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 05.08.2020 – 2 BvR 1985/19, 2 BvR 1986/19 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Oberlandesgericht Hamm musste sich im Herbst 2016 erneut mit der Reichweite der Beleidigungsdelikte nach §§ 185 ff. StGB beschäftigen. Die Richter legten obergerichtlich fest, dass die Bezeichnung eines 58-jährigen Mannes als „alter Mann“ nicht den Straftatbestand des § 185 StGB erfüllt, da es sich um eine Tatsachenbehauptung handelt, welche die betroffene Person grundsätzlich nicht herabwürdigt.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte wurde in einem Streitgespräch mit dem Opfer verwickelt. Als sich die verbale Auseinandersetzung intensivierte, soll dieser sein Opfer als „Opa“ sowie „alter Mann“ betitelt haben. Mangels sicherer Feststellungen seitens des erstinstanzlichen Tatrichters ist in Bezug auf das Phänomen der „Wahlfeststellung“ lediglich auf die Aussage des „alten Mannes“ einzugehen.
Das erstinstanzliche Amtsgericht sah in der Aussage des Angeklagten eine ehrenrührige Tatsachenbehauptung, welche im Einzelfall dazu geeignet ist, eine Ehrverletzung beim Opfer herbeizuführen, was eine Verurteilung aufgrund § 185 StGB rechtfertigt.
Gegen dieses Urteil wehrt sich der Angeklagte mit einer Revision zum Oberlandesgericht Hamm. Die Richter sahen den Tatbestand des § 185 StGB nicht erfüllt und hoben das Urteil des Amtsgerichtes demnach auf. Dies wurde seitens der Richter wie folgt begründet:
Die Verurteilung des Angeklagten wegen Beleidigung kann nicht bestehen bleiben, da sie von den Feststellungen des erstinstanzlichen Gerichtes nicht getragen wird. § 185 StGB verlangt einen Angriff auf die Ehre einer Person durch Kundgabe von Missachtung. Der Äußerungsgehalt, welcher unter diesen Umständen fällt, ist unter Berücksichtigung aller Begleitumstände zu ermitteln. Dabei ist der Maßstab ausschlaggebend, wie ein verständiger Dritter die Äußerung verstehen würde.
Demnach ist eine objektiv erhobene Tatsachenbehauptung, welche an sich als „wertneutral“ verstanden werden kann, nicht als Beleidigung im Sinne des § 185 StGB anzusehen.
Die Aussage, dass das 58 – jährige Opfer ein „alter Mann“ sei, sei auch im Hinblick auf sein tatsächliches Lebensalter für sich betrachtet noch keine ehrenrührige Herabwürdigung oder Diskreditierung der Person, welcher dem Opfer seinen personalen oder sozialen Geltungswert abspricht und seine Minderwertigkeit zum Ausdruck bringt. Vielmehr liegt ein objektives „altes Aussehen“ des Opfers vor, welches nicht durch abfällige oder beleidigende Zusatzbemerkungen verstärkt wurde, welche eine solche Diskreditierung rechtfertigen oder tragen würden.
Letztendlich sieht das Oberlandesgericht Hamm von einer Zurückverweisung der Sache zur konkreteren Feststellung des Sachverhaltes sowie der „etwaigen Beleidigungshandlung“ ab. Da aus Sicht der Richter keine weiteren Erkenntnisse zu erwarten sind und die vorliegenden Feststellungen keine „ausreichende“ Herabwürdigung der Person beinhalten, so sind die Richter des OLG in der Pflicht, dass vorherige amtsgerichtliche Urteil aufzuheben, da es nicht die Voraussetzungen der strafrechtlichen Beleidigungsnorm aus § 185 StGB erfüllt sieht.
Demnach wurde der Angeklagte in der Revisionsinstanz freigesprochen.
OLG Hamm, Beschl. v. 26.09.2016 – 1 RVs 67/16
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Oberlandesgericht Hamm hat sich im Sommer 2018 mit der allseits bekannten Pyrotechnik-Problematik in deutschen Fußballstadien auseinandersetzen müssen. Die Richter aus Hamm setzten ein Zeichen gegen solch ein gefährliches Verhalten und verurteilten einen Fan zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten ohne Bewährung.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Ein damals 23 – jähriger Anhänger des FC Schalke 04 war einer der führenden Mitglieder der Fan-Gruppierung „Hugos“. Da es in diesem Umfeld des Öfteren auch zu körperlichen Auseinandersetzungen mit anderen Fan-Gruppierungen kommt, war dieser bereits strafrechtlich mehrfach aufgrund Körperverletzungsdelikten in Erscheinung getreten. Sein letztes Körperverletzungsdelikt zog eine einjährige Jugendstrafe mit sich, wessen Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Im November 2013 plante der Angeklagte zusammen mit weiteren Mitgliedern der „Hugos“ eine eingeübte Choreographie, welche während des Heimspiels des FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt im Fanblock gezeigt werden sollte. Bei dieser Inszenierung soll es sich vorwiegend um die ungerechte Ausschließung der Fangruppierung von bestimmten Auswärtsspielen handeln.
Zu Beginn der zweiten Halbzeit zeigte die Gruppierung ein Banner nach oben. 19 Mitglieder der „Hugos“ befanden sich in unmittelbarer Nähe zum Banner und entzündeten zeitgleich 19 Seenotrettungsfackeln. Diese verbreiteten toxische Rauchgase, durch welche acht unbeteiligte Stadionbesucher, unter anderem ein 12 Jahre altes Kind, zum Teil erhebliche Rauchgasverletzungen erlitten.
Konsequenz der Handlung war eine Verurteilung des Angeklagten vor dem Schöffengericht aufgrund gefährlicher Körperverletzung, gemeinschaftlicher Sachbeschädigung sowie etwaigen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Das Strafmaß sei eine Freiheitsstrafe von einem Jahr sowie sechs Monaten, ohne dass deren Vollzug dabei auf Bewährung ausgesetzt wurde.
Um dennoch eine Strafaussetzung zur Bewährung zu erreichen, legte der Angeklagte Revision gegen das schöffengerichtliche Urteil zum Oberlandesgericht ein. Diese blieb jedoch erfolglos, denn das OLG Hamm hat das Berufungsurteil des vorher zuständigen Landgericht Essen bestätigt. Die Richter begründeten dies wie folgt:
Die gerügte Strafzumessung sei rechtsfehlerfrei. Die Zahl der Geschädigten sowie auch die Unbeherrschbarkeit der vom Angeklagten gezielt heraufbeschworenen Gefahrenlage seien extrem strafschärfend zu berücksichtigen. Zudem sei zu beachten, dass der Angeklagte bereits zuvor in regelmäßigen Abständen strafrechtliche Auffälligkeiten an den Tag legte und eine gesellschaftliche Besserung der Situation im Sinne der Straftaten nicht ersichtlich sei. Die notwendige positive Sozialprognose, welche für eine Bewährungsaussetzung notwendig wäre, wurde seitens des Landgerichtes zu Recht verneint. Dies sei auch zwingend notwendig gewesen, denn eine im Jahre 2012 verhängte Bewährungsstrafe habe den Angeklagten nicht von der Begehung weiterer Straftaten abhalten können.
Dennoch spreche andererseits auch für den Angeklagten, dass die Auswirkung einer vollstreckten Freiheitsstrafe seine berufliche Zukunft als auch seine bislang positiven Ergebnisse und Verlaufserscheinungen in seiner Schule – sowie Berufsausbildung stark beeinträchtigen und dementieren könnten. Dennoch haben die Richter des Schöffengerichts diese Auswirkungen bereits ausreichend und mit gebotenem Maße bei der Strafzumessung berücksichtigt, dass auch in diesem Fall kein Rechtsfehler ersichtlich ist.
Letztendlich war die Freiheitsstrafe von einem Jahr und sechs Monaten verhältnismäßig, obwohl sich der Angeklagte noch im jugendlichen Alter befand.
OLG Hamm, Beschluss vom 11.08.2015 – 5 RVs 80/15 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Foto: Fotolia / AdobeStock
Der Bundesgerichtshof hat in einem Beschluss aus dem Jahre 2016 festgestellt, dass der Konsum von Heroin zur Linderung von erheblichen krankheitsbedingten Schmerzen nicht unter den gerechtfertigten Notstand nach § 34 StGB fällt, denn die Schmerzlinderung könne immer noch durch andere Maßnahmen erreicht werden.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Im Jahre 2013 litt die Beschuldigte an einem massiven Schub ihrer Sarkoidose-Erkrankung. Aufgrund der damit einhergehenden erheblichen Schmerzen war ihr es nicht mehr möglich, ihr Bett zu verlassen. Als auch die vom Arzt verschriebenen Schmerzmittel nicht mehr geholfen haben und die Beschuldigte sich weigerte, weitere morphinhaltige Medikamente zu sich zu nehmen, beschaffte sie sich mit ihren letzten Kräften Heroin, um ihre Schmerzen weitestgehend zu lindern.
Aufgrund des dauerhaften Konsums und der damit einhergehenden Schmerzunterdrückung war Sie wieder in der Lage zur Arbeit zu gehen und sich um ihre Kinder zu kümmern. Nachdem die Frau jedoch im Dezember 2014 bei der Übergabe von 58 Gramm Heroin von der Polizei beobachtet wurde, wurde sie unter anderem wegen unerlaubten Sichverschaffens von Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen angeklagt und vom Landgericht Nürnberg-Fürth zu einer Haftstrafe verurteilt.
Dagegen wandte sich die Verurteilte mit einer Revision zum Bundesgerichtshof. Sie argumentierte, dass Sie die Drogen aufgrund ihrer Krankheit entgegennahm und diese ihr wieder einen lebenswürdigen Alltag schenken würden, was unter den Voraussetzungen des gerechtfertigten Notstandes nach § 34 StGB rechtmäßig sein müsse.
Die Richter des Bundesgerichtshof schlossen sich der Entscheidung des Landgerichts an und wiesen die Revision der Frau daher zurück. Sie habe sich demnach wegen unerlaubten Sichverschaffens von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge strafbar gemacht. Dies begründeten die Richter wie folgt:
Die Notstandslage nach § 34 StGB kann als gegeben angesehen werden, da zum Zeitpunkt der Tat für die Frau aufgrund ihrer Krankheit eine gegenwärtige Gefahr für ihre Gesundheit bestand. Dennoch bedarf es hinsichtlich der Notstandshandlung auch einer bestimmten „Erforderlichkeitsschwelle“, welche erst dann erfüllt ist, wenn keine anderen möglichen milderen Mittel zur Verfügung stehen, um die gegenwärtige Gefahr abzuwenden.
Im vorliegenden Fall war jedoch das unerlaubte Verschaffen von Heroin nicht erforderlich, um die mit dem Krankheitsschub einhergehenden Schmerzen zu lindern und die Arbeitsfähigkeit zu erhalten. Der Rückgriff auf die illegale Substanz stellte nicht das mildeste, zur Verfügung stehende Mittel dar. Die Frau hätte sich auch einfach auf legale Möglichkeiten der effektiven Schmerzbehandlung einlassen können.
Dennoch habe Sie vielmehr gleich nach Beginn des Krankheitsschubs auf unerlaubte Drogen zurückgegriffen, ohne einen ernsthaften Versuch zu unternehmen, die durch den behandelnden Arzt vorgeschlagene Medikamentenkur durchzuführen oder bei Bedarf auch etwaige Änderungen herbeizuführen. Auch eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 3 Abs. 2 des Betäubungsmittelgesetzes sei nicht in Betracht gezogen werden, obwohl diese im vorliegenden Fall durchaus möglich gewesen wäre.
Diese Ausnahmeregelung, welche vor allem aufgrund der Behandlung durch Cannabisprodukte in das Rampenlicht gerückt ist, sei auch für Heroinprodukte anwendbar, welche zu therapeutischen Zwecken verwendet werden. In diesem Zusammenhang verweisen die Richter darauf, dass mit für die Substitutionsbehandlung zugelassenes Diamorphin ein mit Heroin substanzgleiches Produkt mit gleicher Wirkung zur Verfügung stehe und vor allem aufgrund dieses Umstandes eine Erforderlichkeit zwingend abzulehnen ist.
Letztendlich scheiterte die Revision beim Bundesgerichtshof und es kam zur Bestätigung der landgerichtlichen Verurteilung.
Bundesgerichtshof, Beschluss vom 28.06.2016 – 1 StR 613/15 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht