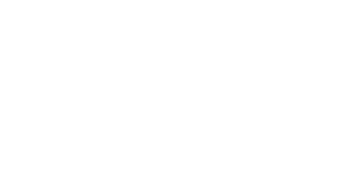Sven Skana
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin
Kurfürstendamm 167
Adenauer-Platz |
10707 Berlin
Ihr Anwalt für Strafrecht in Berlin - Rechtsanwalt Sven Skana
Sie haben als Beschuldigter ein Anhörungsformular von der Polizei erhalten und sind sich aber keiner Schuld bewußt?
Ich bin Fachanwalt für Verkehrsrecht und Anwalt für Strafrecht mit mehr als 25-jähriger Erfahrung und berate Sie gerne in allen Fragen zu Strafsachen. Ich stehe Ihnen in jeder Verfahrenslage für eine erfolgreiche Verteidigung in Berlin und auch Deutschlandweit zur Seite.
Damit Sie den Ermittlungs- und Justizbehörden (Polizei, Staatsanwaltschaft, Zoll oder Gericht) nicht unvorbereitet entgegentreten müssen, biete ich Ihnen meine langjährige Erfahrung und Sachkenntnis an. In einem Vorgespräch berate ich Sie gerne zu Ihrem Problem und einer möglichen erfolgreichen Verteidigung.
Sie suchen einen Fachanwalt in Berlin, der eine Spezialisierung im Strafrecht hat?
Meine langjährige Erfahrung und Fachkenntnis auf dem Gebiet des Strafrechtes und Strafprozessrechtes sowie die Arbeit als Strafverteidiger in Berlin und bundesweit auf dem gesamten Gebiet des Strafrechts erlauben mir eine kompetente und sehr zielorientierte Verteidigung in großen und kleinen Strafsachen in allen Bereichen des Strafrechtes.
Ich unterstütze und verteidige Sie neben dem allgemeinen Strafrecht auch im Betäubungsmittelstrafrecht, Verkehrsstrafrecht, Jugendstrafrecht, Nebenklagevertretung / Opfervertretung sowie bei der erkennungsdienstlichen Behandlung.

Effiziente und kompetente juristische Beratung in allen Bereichen des Strafrechtes
Informieren Sie sich bitte ganz unverbindlich darüber, was wir für Sie tun können und lernen Sie in Ruhe die Möglichkeiten kennen, die wir für Ihre Problemlösung bereithalten. Die Rechtsanwaltskanzlei Johlige, Skana & Partner hat mit Rechtsanwalt Skana einen Schwerpunkt im Strafrecht. Wir sind in der Lage, Sie effizient, kurzfristig und dennoch kostengünstig zu beraten. Wir haben die Kosten für Sie stets im Blick – so behalten Sie zu jederzeit die volle Kostenkontrolle!
Unser Handeln ist dabei stets auf Ihren Erfolg bei der Lösung Ihres Rechtsproblems ausgerichtet. Denn ein Strafverfahren kann enorme Konsequenzen haben:
- eine hohe Geldstrafe
- eine Haftstrafe
- eine Eintragung in das Führungszeugnis
- eine Entziehung der Fahrerlaubnis
Als Rechtsanwalt und Strafverteidiger in Berlin und dem ganzen Bundesgebiet aktiv in den Bereichen:

- Allgemeines Strafrecht
Im Allgemeinen Strafrecht werden alle Delikte aus dem Strafgesetzbuch (StGB) eingeordnet, die man keinem speziellen Strafrecht zuordnen kann und die nicht Bestand von Nebengesetzen im Strafrecht sind. Das heißt aber nicht, dass eine Strafverfolgung im Allgemeinen Strafrecht nicht der Betreuung eines erfahrenen und kompetenten Strafverteidigers bedarf. Sie sollten unbedingt auch bei Strafverfahren im Allgemeinen Strafrecht einen Rechtsanwalt aufsuchen, der die Sachlage prüft und bewertet. Weiter lesen …

- Betäubungsmittel Strafrecht (BTM)
Das Betäubungsmittelstrafrecht (BtMG) oder auch gerne umgangssprachlich Drogenstrafrecht genannt, ist ein aus dem Strafgesetzbuch (StGB) ausgegliedertes Spezialgesetz, das sich mit Strafhandlungen in Zusammenhang mit Betäubungsmitteln (Drogen wie z.B. Amphetamin, Cannabis) beschäftigt. Ziel des Betäubungsmittelgesetzes ist die Bekämpfung der Betäubungsmittel Kriminalität (Drogenkriminalität) wie Drogenhandel und richtet sich gegen Händler (Dealer) und Konsumenten. Weiter lesen …

- Verkehrsstrafrecht
Das Verkehrsstrafrecht beschäftigt sich mit sämtlichen Delikten in Zusammenhang mit dem Straßenverkehr, wie die Gefährdung des Straßenverkehrs (§ 315c StGB), Trunkenheit im Straßenverkehr (§ 316 StGB), der gefährliche Eingriff in den Straßenverkehr (§ 315b StGB) oder die Fahrerflucht oder auch Unfallflucht – das unerlaubte Entfernen vom Unfallort (§ 142 StGB). Von Geldstrafen über Fahrverbot oder Führerscheinentzug bis hin zu Freiheitsstrafen reicht das Spektrum möglicher Strafen im Verkehrsstrafrecht. Weiter lesen …

- Jugendstrafrecht
Das Jugendstrafrecht findet in Strafverfahren Anwendung, in denen der Täter einer Straftat oder eines Deliktes nach allgemeinem Strafrecht nicht belangt werden kann. Das ist der Fall, wenn der Beschuldigte unter 18 Jahren alt ist. Man unterscheidet dabei zwischen Heranwachsenden (18 – 20 Jahre) und Jugendlichen (14 – 17 Jahre). Ist der Straftäter unter 14 Jahren alt, also ein Kind, ist er gemäß § 19 Strafgesetzbuch (StGB) schuldunfähig und strafunmündig. Im Jugendgerichtsgesetz (JGG) sind Sondervorschriften bei Strafverfahren gegen Jugendliche und Heranwachsende geregelt. Weiter lesen …

- Nebenklage-/ Opfervertretung
Die Nebenklagevertretung oder Opfervertretung durch einen Opferanwalt hilft Opfern einer Straftat oder Hinterbliebenen sich von der großen psychischen Belastung der Opferrolle zu befreien und dem Täter als Kläger gegenüber zu treten. Dabei vertritt der Opferanwalt seine Mandanten mit einer besonders auf die Straftaten (z.B. Tötungsdelikte, Sexualstraftaten, Missbrauch) zugeschnittenen Strategie. Wichtige Punkte dabei sind das Anwesenheitsrecht, Fragerecht, Akteneinsichtsrecht oder Rechtsmittelrecht, die der Opferanwalt für seinen Klienten erwirkt. Weiter lesen …

- Erkennungsdienstliche Behandlung
Die Erkennungsdienstliche Behandlung umfasst die Maßnahmen der Strafverfolgungs Behörden, die zur Erfassung von Informationen der Strafverfolgung nötig sind. Dazu können Fingerabdrücke, Lichtbildaufnahmen, Handflächenabdrücke oder die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale (z.B. Narben, Tätowierungen) gehören. Doch gibt es für eine Erkennungsdienstliche Behandlung genaue Vorschriften (§ 81b der Strafprozessordnung (StPO)), an die sich die Polizei halten muss. Der Rechtsanwalt weiß, wie man sich gegen einige der angeordneten Maßnahmen zur Wehr setzen kann. Weiter lesen …
Sie haben Fragen zu unseren Leistungen oder möchten juristisch beraten werden?
Über 25 Jahre Erfahrung als Rechtsanwalt im Umgang mit dem Strafrecht
- Bundesweite Vertretung ohne Zusatzkosten
- Anwaltswechsel ohne Zusatzkosten
- innovativ
- erfolgsorientiert
- mit über 25 Jahren Erfahrung
- mit guten Kontakten zu Richtern und Behörden
- im gesamten Bundesgebiet
- mit Telefonservice täglich von 08:00 – 20:00 Uhr
Deshalb ist es für eine erfolgreiche Verteidigung sehr wichtig, sich zu einem Tatvorwurf immer erst dann zu äußern, nachdem Einsicht in die Ermittlungsakten genommen wurde.
Aktuelles aus dem Verkehrsrecht

Dem BGH-Beschluss und dem zuvor durch das LG Dortmund erlassenen Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Nachdem der Angeklagte die Betroffene V. im Urlaub im August 2010 kennen gelernt hatte, blieben beide in Kontakt, ohne dass regelmäßige Treffen stattfanden oder sich daraus eine Liebesbeziehung entwickelte.
Die Betroffene fühlte sich Ende desselben Jahres durch den Angeklagten immer stärker vereinnahmt und eingeengt. Anfang 2011 erklärte die Betroffene dem Angeklagten, dass sie aufgrund der Annahme einer Arbeitsstelle kein Interesse an einer (Fern-)Beziehung habe und entfernte ihn später aus ihrer Freundesliste bei Facebook. Zwischen Februar 2011 und März 2012 versuchte der Angeklagte die V. trotzdem mehrfach über Facebook zu kontaktieren. Nach einer Löschung des Facebook-Profils durch V. bemühte sich der Angeklagte um Kontaktaufnahme über die Freundinnen der V und den neuen Lebensgefährten T via Facebook. Auch schrieb er V. und deren Eltern Briefe. Die Aufforderungen der Betroffenen und der zuvor genannten Personen gegenüber dem Angeklagten, V künftig in Ruhe zu lassen, blieben erfolglos. Das LG verurteilte den Angeklagten sodann wegen Nachstellung in Tateinheit mit versuchter Nötigung sowie Bedrohung und wegen vorsätzlicher Körperverletzung zum Nachteil der V. und diverser Zeugen zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr 3 Monaten. Dagegen wendete sich der Angeklagte mit einer erfolgreichen Revision.
Eine Körperverletzung i.S.d § 223 I StGB setzt eine körperliche Misshandlung oder Gesundheitsschädigung voraus. Letztere wird definiert als das Hervorrufen oder Steigern eines vom Normal-
zustand der körperlichen Funktionen des Opfers nachteilig abweichenden Zustandes. Bei rein psychischen Einwirkungen des Täters auf sein Opfer ist zu beachten, dass diese nicht ohne Weiteres den nötigen Körperverletzungserfolg herbeiführen. Vielmehr muss in derartigen Fällen ein pathologischer, somatisch-objektivierbarer Zustand hervorgerufen worden sein, der vom Normalzustand nachteilig abweicht. Ein solcher pathologischer Zustand liegt z.B. bei emotionalen Reaktionen auf Aufregungen (z.B. starke Gemütsbewegungen oder andere Erregungszustände), latenten Angstzuständen, Nervosität oder erhöhter Reizbarkeit ohne nähere Erklärungen grundsätzlich nicht vor.
Nach Ansicht des BGH reichten die im vorliegenden Fall getroffenen Ausführungen zu den deutlich längerfristigen Anpassungsstörungen einer Zeugin, die zuvor bereits vorlagen und sich durch das bedrohende Verhalten des Angeklagten wesentlich gesteigert hatten, als Grundlage für eine Verurteilung nicht aus. Angesichts der Tatsache, dass sich die Zeugin davor bereits in psychiatrischer Behandlung befand, wären weitere, konkretere Erklärungen zu der Anpassungsstörung der Zeugin und zur Eigenständigkeit des Körperverletzungserfolges nötig gewesen.
Zudem setzt das Vorliegen des Tatbestandes des § 223 I StGB die Überschreitung einer Erheblichkeitsschwelle voraus. Vor diesem Hintergrund wäre es auch bzgl. der Schlafstörungen und Albträume der Zeugin erforderlich gewesen, konkret zu vermitteln, inwiefern die Gesundheit der Zeugin dadurch erheblich beeinträchtigt wurde. Als Beispiel dient eine dauerhafte Veränderung des Schlafverhaltens. Normale körperliche Reaktionen auf eine bedrohende oder belastende Situation wie z.B. Herzrasen oder Weinkrämpfe genügen ohne konkrete Schilderungen ebenso wenig für die Einordnung als erhebliche Gesundheitsbeeinträchtigung wie die unkonkrete Ausführung, dass das Opfer infolge des Täterverhaltens eine einwöchige Krankschreibung erhalten hat.
Die Erheblichkeitsschwelle wird ferner dann nicht überschritten, wenn es zu zeitlich begrenzten Reaktionen des Opfers kommt. Wenn das Opfer also durch das Täterverhalten unter kurzfristigen Angstzuständen oder an temporären Schwindelzuständen leidet, so genügt dies nicht. Nicht ausreichend ist auch eine kurze reaktive depressive Erkrankung. Kommt es jedoch zu einer längerfristig anhaltenden, massiven depressiven Verstimmung aufgrund äußerer belastender Umstände, verändert dies die Sachlage.
Neben der Erheblichkeit des Körperverletzung sei auch noch einmal auf die Notwendigkeit des Vorliegens eines objektivierbaren Zustandes hingewiesen. Fühlt sich das Opfer z.B. hilflos oder kraftlos und aufgrund der psychischen Verfassung nicht in der Lage, seiner beruflichen Tätigkeit weiter nachzugehen, so ist das eine rein subjektive Sicht auf die Dinge.
BGH, Beschl. v. 18.07.2013 – 4 StR 168/13 (LG Dortmund) Foto: AdobeStock Nr. 262252375
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das OLG Dresden hat in einem aktuellen Beschluss klargestellt, dass eine Alkoholmessung, bei der die Kontrollzeit von 10 Minuten nicht eingehalten wurde, dann nicht verwertbar ist, wenn der Grenzwert gerade erreicht oder nur geringfügig überschritten wurde.
Sachverhalt: Der Betroffene führte am 7.12.2018 unter Außerachtlassung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt um 1:18 Uhr einen Pkw mit einer Atemalkoholkonzentration von 0,25 mg/l oder mehr. Die Festgestellte Atemalkoholkonzentration betrug 0,26 mg/l. Die Feststellung der Atemalkoholkonzentration erfolgte mit dem Gerät Dräger AL-Cotest 9510 DE.
Es konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Betroffene während der Kontrollzeit von 10 Minuten vor Beginn der Messung ein Lutschbonbon „Fisherman’s Friend“ im Mund hatte. Dieses hatte er zu Beginn der Messung verschluckt. Das durch den Bußgeldrichter eingeholte Gutachten bewies, dass das Lutschen des Bonbons in der Kontrollzeit keinen Einfluss auf die Messung hatte. Der Bußgeldrichter ging daher von einer Atemalkoholkonzentration von 0,26 mg/I nach Durchführung der Beweisaufnahme aus.
Das Gericht begründete seinen Beschluss u.a. wie folgt:
„Bei der Bestimmung der Atemalkoholkonzentration handelt es sich um ein standardisiertes Messverfahren. Der Gesetzgeber hat ausdrücklich vorgesehen, dass bei der Atemalkoholbestimmung nur Messgeräte eingesetzt und Messmethoden angewendet werden dürfen, die den im Gutachten des Bundesgesundheitsamtes gestellten Anforderungen genügen (BGHSt, 46, 358 ff.). Nach diesem Gutachten des Bundesgesundheitsamtes besteht für das Messverfahren neben dem Erfordernis einer Kontrollzeit von zehn Minuten vor der Atemalkoholmessung unter anderem die Vorgabe, dass zwischen der Beendigung der Alkoholaufnahme (Trinkende) und der Atemalkoholmessung ein Zeitraum von 20 Minuten verstrichen sein muss. Die vorgeschriebene Kontrollzeit von zehn Minuten vor der ersten Messung dient dazu, die Gefahr der Verfälschung der Messwerte durch Mund- oder Mundrestalkohol auf das Messergebnis auszuschließen. In der sogenannten Kontrollzeit von zehn Minuten muss gewährleistet sein, dass der Betroffene keinerlei Substanzen mehr zu sich genommen hat (OLG Karlsruhe, NStZ-RR 2006, 250).
Wenn diese Kontrollzeit von zehn Minuten nicht eingehalten wird, muss dies zumindest in den Fällen, in denen der Grenzwert gerade erreicht oder nur ganz geringfügig überschritten worden ist, zur Unverwertbarkeit der Messung führen.“
Nur unter der Voraussetzung, dass binnen eines Zeitraumes von zehn Minuten vor der Messung der Betroffene keinerlei Substanzen, insbesondere alkoholhaltiger Art, mehr im Rachenraum hatte, kann mit Sicherheit gewährleistet werden, dass das mittels des Messgerätes Dräger Evidential 7110 bzw. Dräger ALCOTEST 9510 DE gewonnene Ergebnis nicht durch Rückstände im Rachenraum beeinträchtigt worden ist. Demnach liegt nur bei Einhaltung dieser Kontrollzeit – jedenfalls bei bloßem Erreichen des Grenzwertes bzw. bei nur geringfügiger Überschreitung desselben – ein verwertbares Messergebnis vor.
Mit den Feststellungen des Amtsgerichts in den Urteilsgründen ist somit nicht der Nachweis erbracht, dass sich der Betroffene zur Tatzeit im Sinne des § 24 a Abs. 1 OWiG ordnungswidrig verhalten hat.
Beschluss, OLG Dresden vom 28.04.2021
Foto: AdobeStock Nr. 280265607 Symbolfoto
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Zum Sachverhalt: Der Beschuldigte war um 1:55 Uhr innerorts mit einem E-Scooter gefahren. Die BAK betrug 1,28 Promille. Das AG hatte die Fahrerlaubnis vorläufig nach § 111 a StPO entzogen.
Zur Begründung hat es ausgeführt, dass der Angeklagte dringend verdächtig war, ein Fahrzeug (E-Scooter) geführt zu haben, obwohl er infolge des Genusses alkoholischer Getränke nicht in der Lage gewesen war, das Fahrzeug sicher zu führen. Gegen diesen Beschluss hatte der Angeklagte Beschwerde eingelegt mit der Begründung das AG sei zu Unrecht von einer absoluten Fahruntüchtigkeit ausgegangen, da für deren Annahme in Bezug auf E-Scooter die Schwelle eines Blutalkoholgehalts von 1,6 Promille, also jene, die für das Führen von Fahrrädern im Straßenverkehr angesetzt werde, maßgeblich sei.
E-Scooter seien allerdings weder mit Pkws noch mit Motorrädern vergleichbar. Vielmehr würden sie Fahrrädern mit elektrischem Hilfsantrieb ähneln, für die eine absolute Fahruntüchtigkeit erst ab einem Wert von 1,6 Promille angenommen würde. Daraufhin hat das AG die Beschwerde dem LG zur Entscheidung vorgelegt.
Das LG hatte den AG Beschluss aufgehoben, die Beschwerde war zulässig und begründet. Nach Ansicht des LG lagen die Voraussetzungen für eine vorläufige Entziehung der Fahrerlaubnis nach
§ 111 a Abs. 1 StPO nicht vor. Das LG sah keine dringenden Gründe für die Annahme, dass der Angeklagte gem. § 69 Abs. 1 StGB die Fahrerlaubnis entzogen werde. Die Regelvermutung des
§ 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB könne hier ausnahmsweise widerlegt werden und der Angeklagte nicht als ungeeignet angesehen werden. Dabei könne offenbleiben, ob auf Fahrten mit E-Scootern der für die Fahrtuntüchtigkeit bei Kraftfahrzeugen geltende Grenzwert einer BAK von 1,1, Promille anzuwenden sei oder ob für sie der Grenzwert für Fahrradfahrer von 1,6 Promille gelte. Denn selbst wenn von einem Grenzwert von 1,1 Promille auszugehen wäre und damit bei einer BAK 1,27 Promille der Tatbestand des § 316 Abs. 1 StGB verwirklicht sei, so komme doch ein Absehen von der Regelwirkung des § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB in Betracht.
Entgegen dieser Regelvermutung könne bei einer Verwirklichung des § 316 StGB von der Entziehung der Fahrerlaubnis abgesehen werden, wenn besondere Umstände vorlägen, die ihrer allgemeinen Natur nach schwere und gefährliche Verstöße günstiger erscheinen lassen würden als den Regelfall. Ein solcher Umstand ergebe sich bereits aus der Tatsache, dass sich das abstrakte Gefährdungspotenzial von E-Scootern erkennbar von dem der „klassischen“ Kraftfahrzeuge, wie Pkws, Lkws, Krafträdern etc. unterscheide. Dies ergebe sich bereits aus der durch Gewicht und Höchstgeschwindigkeit bestimmten äußeren Beschaffenheit von E-Scootern. In aller Regel weisen diese ein Gewicht von ca. 20 bis 25 kg und eine mögliche Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h auf.
Hieran wird bereits deutlich, dass für die Beurteilung des Gefährdungspotenzials von E-Scootern die technischen Daten entscheidend seien, die in erster Linie mit einem Fahrrad oder einem Fahrrad mit elektrischen Hilfsantrieb (sog. Pedelecs) vergleichbar seien. Auch der Gesetzgeber selbst hat explizit festgehalten, dass die Fahreigenschaften sowie die Verkehrswahrnehmung von Elektrokleinstfahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von 12 km/h bis 20 km/h am stärksten denen des Fahrrads ähneln würden, wodurch – nach der Vorstellung des Gesetzgebers – verkehrs- und verhaltensrechtlich die Regelungen über Fahrräder gelten sollten, sofern keine besonderen Vorschriften erlassen würden.
Die Leistungsanforderungen beim Führen eines E-Scooters, insbesondere das Halten des Gleichgewichts und die kontrollierten Lenkbewegungen, seien nahezu identisch mit denen des Fahrens auf einem Fahrrad.
Aufgrund dieser Parallelität bezüglich des Gefährdungspotenzials zwischen E-Scootern und Fahrrädern sei bei der Anwendung des § 69 StGB im Zusammenhang mit einer Trunkenheitsfahrt auf einem E-Scooter grundsätzlich zu berücksichtigen, dass eine gem. § 316 StGB möglicherweise strafbare Trunkenheitsfahrt mit einem Fahrrad gerade nicht die Entziehung der Fahrerlaubnis nach
§ 69 StGB nach sich ziehe und insoweit, abhängig von den Umständen des Einzelfalls, Wertungswidersprüche entstehen können. Daher könne nicht ohne weiteres von der Regelvermutung des §69 Abs. 2 Nr. 2 StGB ausgegangen werden. Bei einer Trunkenheitsfahrt mit einem E-Scooter müsse vielmehr geprüft werden, ob daraus auf eine Verantwortungslosigkeit des Betroffenen geschlossen werden könne, die mit einer Trunkenheitsfahrt mit klassischen Kraftfahrzeugen vergleichbar sei und damit eine Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen rechtfertigen würde.
Im vorliegenden Fall gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass der Betroffene durch seine begangene Trunkenheitsfahrt mit dem E-Scooter in irgendeiner Form gegenüber dem abstrakten Gefährdungspotenzial eine erhöhte Gefährdungslage geschaffen hätte. Daher könne auch keine Ungeeignetheit zum Führen von Kraftfahrzeugen nachgewiesen werden. Außerdem war der Ermittlungsakte zu entnehmen, dass der Betroffene auf einem Fahrradweg über eine relativ kurze Strecke von 15 cm leichte Schlangenlinien fuhr. Anderweitige Ausfallserscheinungen im Verkehr, die eine Gefährdung von Personen oder Sachen hätten verursachen können, waren nicht ersichtlich.
Daher lag es in diesem Fall nahe, die Regelvermutung des § 69 Abs. 2 Nr. 2 StGB als wiederlegt anzusehen. Die Voraussetzungen des § 69 StGB lagen nicht vor. Daher wurde der Beschluss des AG aufgehoben.
LG Halle, Beschluss vom 16.7.2020 – 3 Qs 81/20
Foto: AdobeStock Nr. 437915683
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Auch auf frei zugänglichen Privat-Parkplätzen kann entsprechend § 13 Abs. 2 Nr. 2 StVO die Pflicht bestehen, eine Parkscheibe gemäß Bild 318 der Anlage 3, Abschnitt 3 Nr. 11 zu § 42 Abs. 2 StVO von außen „gut lesbar“ hinter der Frontscheibe, hinter der Heckscheibe oder an der Seitenscheibe anzubringen. Dies hat das Amtsgericht Brandenburg entschieden.
Folgender Sachverhalt lag dem Fall zugrunde: Ein Pkw-Fahrer stellte im Januar 2019 sein Fahrzeug auf einen Kundenparkplatz für ein nahegelegenes Einkaufszentrum in Brandenburg ab. Nach den Vertragsbedingungen war das kostenfreie Parken für eine Stunde erlaubt. In Fällen der Überschreitung der Höchstparkdauer in denen für Außenstehende keine gut lesbaren Parkscheiben ausgelegt waren, wurde ein erhöhtes Parkentgelt fällig. Die Vertragsbedingungen waren auch deutlich auf den Hinweisschildern sichtbar.
Mit der Begründung, dass der Pkw-Fahrer keine Parkscheibe ausgelegt hat, machte die Eigentümerin des Parkplatzes ein erhöhtes Parkentgelt i.H.v. 15 € geltend. Der Pkw-Fahrer verweigerte daraufhin die Zahlung und gab an, dass er eine Parkscheibe gut sichtbar in den Kofferraum seines Pkw gelegt habe. Die Parkplatz- Eigentümerin ließ dies jedoch nicht gelten und erhob Klage gegen ihn.
Das AG Brandenburg entschied zu Gunsten der Parkplatz-Eigentümerin. Nach Ansicht des Gerichts stünde ihr das erhöhte Parkentgelt in Form einer Vertragsstrafe i.H.v. 15 € zu. Durch das Abstellen des Fahrzeugs habe der Fahrzeugführer mit der Beklagten wirksam vereinbart, dass ein erhöhtes Parkentgelt dann fällig wäre, wenn für einen Außenstehenden keine gut lesbare Parkscheibe ausgelegt sei. Die Höhe der Vertragsstrafe sei auch zur Abschreckung vor der Überschreitung der Höchstparkdauer geeignet. Nur mit Hilfe einer solchen Strafe können Dauerparker von der Benutzung des Parkplatzes abgehalten werden.
Nach Ansicht des Amtsgerichts habe der Beklagte nicht ordnungsgemäß eine Parkscheibe ausgelegt. Der Beklagte habe sein Fahrzeug auf einen für die Öffentlichkeit geöffneten Parkplatz abgestellt. Die Vorschriften der StVO gelten entsprechend. Danach sei das Parken entsprechend § 13 Abs. 2 Nr. 2 StVO nur erlaubt, wenn in dem Fahrzeug eine von außen „gut lesbare“ Parkscheibe gemäß Bild 318 der Anlage 3, Abschnitt 3 Nr. 11 zu §42 Abs. 2 StVO hinter der Windschutzscheibe, auf der Abdeckplatte des Gepäckraums (Hutablage) oder an der Seitenscheibe angebracht wird. Das Auslegen einer Parkscheibe im Kofferraum, auch wenn dieser von der Heckscheibe aus gegebenenfalls einsehbar sein sollte, reiche nicht aus.
AG Brandenburg a.d. Havel, Urteil vom 23.10.2020
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt.
Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gern im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Das Oberlandesgericht Hamburg hat bereits im Jahre 1980 ein wegleitendes Urteil gefällt, welches uns bis zum heutigen Tage im öffentlichen Verkehr zum Thema Schwarzfahren begleitet. Demnach mussten die Richter sich mit der Strafbarkeitsschwelle des § 265a StGB auseinandersetzen. Dieser straft das gezielte Erschleichen von Leistungen, beispielsweise die klassische „Schwarzfahrt“. In diesem Kontext kam die Frage auf, ob eine Strafbarkeit nach § 265a StGB möglicherweise bereits vorliegt, wenn man bereits den Bahnsteig ohne das vorherige Lösen eines gültigen Fahrscheines betritt. Die Richter entschieden sich gegen diese Auslegung und argumentierten, dass ein Bahnsteig keine „Einrichtung“ im Sinne des § 265a StGB darstellt und somit bereits aufgrund der Wortlautgrenze nicht unter die Norm fallen dürfe.
Dem Urteil liegt folgendes Geschehnis zugrunde:
Ein Mann aus Hamburg, welcher bereits mehrfach von sämtlichen U – sowie S – Bahnhöfen in Hamburg mithilfe eines Platzverweises vertrieben wurde, hielt sich eines Tages trotz des auferlegten Hausverbotes am Bahnsteig des U-Bahnhof Stephanplatz auf. Obwohl der Zutritt zu der gesamten Bahnanlage nach den Beförderungsbedingungen des Verkehrsunternehmers lediglich mit einer gültigen Fahrkarte gestattet war, konnte der Mann diese nicht vorweisen.
Dies führte dazu, dass das Sicherheitspersonal die Polizei verständigte, den Mann vom Bahngelände verwies und eine Anzeige aufgrund Hausfriedensbruch nach § 123 StGB stellte. Das Amtsgericht Hamburg verurteilte den Mann deshalb wegen Hausfriedensbruch sowie noch weiterer offener Delikte zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten auf Bewährung.
Die Staatsanwaltschaft pochte in ihrer Anklage jedoch auch auf die Verurteilung wegen des Erschleichens von Leistungen gemäß § 265a StGB, da sich der Mann bereits eine Möglichkeit geschaffen hat, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen, ohne in dem Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Es folgt die Revision zum Oberlandesgericht Hamburg.
Die Richter lehnten die Revision als unbegründet ab. Aus Sicht des Oberlandesgerichts Hamburg habe sich der Angeklagte nicht wegen Erschleichens von Leistungen als sogenannter Schwarzfahrer strafbar gemacht. Für die Erfüllung des Straftatbestands des § 265a StGB bedarf es einer „Einrichtung“, welche voraussetzt, dass mit der Gewährung des Zutritts eine vermögenswerte Leistung angeboten werde, die auch dem Zweck der Einrichtung entspreche. Dies sei beispielsweise bei öffentlich-zugänglichen Stätten wie Zoos, Schwimmbädern, Kinos, oder Museen der Fall. Ein für den Zugverkehr dienender Bahnsteig oder eine vergleichbare Bahnanlage ist von der Teilnahme am Zugverkehr zu differenzieren. Die Möglichkeit, dem Zugbetrieb zuzuschauen, Reisende dort abzusetzen oder dort abzuholen sowie an Kiosken einzukaufen, stellt nicht den Hauptzweck des Bahnsteigs dar und ist somit nicht als vermögenswerte Leistung im Sinne des § 265a StGB anzusehen, die mit der alleinigen Gewährung des Zutritts auf den Bahnsteig angeboten wird.
Man muss beachten, dass hier lediglich die strafrechtlichen Konsequenzen seitens des OLG Hamburg ausgehebelt wurden. Auch wenn der § 265a StGB nicht erfüllt ist, so kann ein zivilrechtlicher Verstoß gegen die Beförderungsbedingungen des Verkehrsunternehmens eine Erhebung des erhöhten Beförderungsentgeltes mit sich bringen.
Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 04.12.1980 – 1 Ss 232/80 –
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht
Mit dieser Frage musste sich das Oberlandesgericht Saarbrücken im Oktober 2020 beschäftigen. Demnach musste geklärt werden, ob dem Verkäufer, welcher dem Kaufinteressenten ohne Fahrerlaubnis die Schlüssel aushändigte und ihn mit dem Wagen addiert mehrere hundert Kilometer zurücklegen ließ, ein bedingter Vorsatz im Sinne des § 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG vorgeworfen werden kann. Die Richter des Oberlandesgerichts sind in der Revisionsinstanz zu dem Ergebnis gekommen, dass keine ausreichenden Anhaltspunkte für eine Vorsatztat bestehen, das Urteil demnach aufgehoben und für eine erneute Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts zurückverwiesen wird.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte arbeitet als Verkäufer in einem Autohaus. In seiner Funktion war er durch die Geschäftsführung berechtigt, in eigener Verantwortung Fahrzeuge an interessierte Kunden herauszugeben, damit diese Probefahrten mit den Autos durchführen können. Im vorliegenden Fall überließ er zwei verschiedene Autotypen dem Kunden K, welcher zum Zeitpunkt der Probefahrten nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Da sich der Angeklagte kein Führerscheindokument vorlegen lässt, handelt er in der Annahme, dass der Kaufinteressent wohl eine Fahrerlaubnis besitzt. Das Landgericht legte dieses Verhalten derart aus, dass es sich hier um einen bedingten Vorsatz seitens des Angeklagten handele, da dieser den Umstand des fehlenden Führerscheins zumindest billigend in Kauf genommen hat, da er auf eine Sichtung der Dokumente verzichtete. Später ließ sich der Betroffene bei Gericht ein, dass sein Leitmotiv lediglich der vereinfachte Verkauf des Fahrzeuges gewesen sei, um schnellstmöglich eine Provisionsleistung seitens des Arbeitgebers zu kassieren.
Gegen diese Entscheidung legte der Angeklagte Revision zum Oberlandesgericht ein. Die Richter folgten seiner Sachrüge und hoben das Urteil des Landgerichts auf. Zudem verwiesen Sie die Sache an eine andere Strafkammer zur erneuten Entscheidung.
Grund dafür sei, dass aus Sicht der Richter des OLG lediglich ein fahrlässiger Tatbestand des § 21 Abs.2 Nr.1 StVG erfüllt sei. Die Ausführungen des LG zur vorsätzlichen Begehungsweise fußen nicht auf einer ausreichenden Grundargumentation. Der Umstand, dass der Angeklagte es tatsächlich gebilligt habe, dass der Kunde die ihm überlassenen Fahrzeuge ohne die erforderliche Fahrerlaubnis führen würde, kann nicht hinreichend belegt werden. Hier ist wohl eher davon auszugehen, dass der Betroffene den Umständen nach wirklich an den Besitz einer Fahrerlaubnis geglaubt habe, den Zugriff auf das Auto des Kaufhauses jedoch nur aufgrund Außerachtlassung der gebotenen Vorsichtsmaßnahmen einräumte. An diesem Punkt verwiesen die Richter auf die vom Bundesgerichtshof anzuwendende Abgrenzung zwischen Vorsatz und Fahrlässigkeit im Sinne der sogenannten „Einwilligungstheorie“, nach welcher von Vorsatz auszugehen ist, falls der Angeklagte den Erfolg für möglich und nicht ganz fernliegend erkennt und diesen zudem billigend in Kauf nimmt. Im obigen Fall sprechen jedoch keine Feststellungen dafür, dass der Beschuldigte an dem Besitz der Fahrerlaubnis des potentiellen Käufers zweifelt, er prüft diese lediglich nicht aufgrund Unachtsamkeit. Dies stellt einen typischen Fahrlässigkeitsvorwurf dar.
Dafür spricht auch, dass der Angeklagte sich wohl bei einem potentiellen Geschäftsabschluss hätte vorstellen müssen, dass der Kunde nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Für den Kauf eines Fahrzeuges ist eine solche auch nicht notwendig, dennoch ist es wohl unüblich, ein Fahrzeug zu kaufen, welches man zuvor im Anschein „für sich“ probefährt und es sich im Nachhinein herausstellt, dass das Fahrzeug lediglich für Chauffeur-Fahrten genutzt werde. Dies sei ein weiteres Indiz für den Fahrlässigkeitsvorwurf.
OLG Zweibrücken – Az.: 1 OLG 2 Ss 39/20 – Beschluss vom 08.10.2020
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Der Bundesgerichtshof musste sich im Februar 2021 mit dem Strafmaß eines ehemaligen Polizisten auseinandersetzen, welcher im ehemaligen Sondereinsatzkommando des Landes Mecklenburg-Vorpommern gedient habe. Dieser besaß nach Feststellungen des vorherig zuständigen Landgerichts mehrere Kriegswaffen sowie eine Vielzahl an unterschiedlichen Munitionstypen als auch explosionsgefährliche Stoffe in seinem Privathaushalt. Die Richter aus Karlsruhe sprachen eine Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten aus, welche unter strengen Auflagen zur Bewährung ausgesetzt wurde.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Der ehemalige Polizist war Angehöriger des Sondereinsatzkommandos sowie leidenschaftlicher Sportschütze sowie Schießtrainer. Während seiner Ausbildung kam er immer wieder mit Katastrophenszenarien in Berührung, welche in ihm laut eigenen Aussagen eine Art Faszination auslösten. Daraufhin machte er sich auf die Suche nach Gleichgesinnten und fand eine Untergrundgruppierung von Menschen, welche das sogenannte „Preppen“ strukturell betrieben, als die gemeinsame Vorratshaltung von Dingen des täglichen Bedarfs als auch der Bevorratung von Schusswaffen und dessen zugehöriger Munition, um am Eintritt des „Tages X“, dem Zusammenfall der sozialen Ordnung, eine Verteidigungslinie errichten zu können.
Bei den Durchsuchungen des Anwesens des Angeklagten wurden Übungsgranaten der Bundeswehr, ca. 8000 Schuss Munition, welche den Bundes – und Landesministerien zugewiesen werden konnte, eine Maschinenpistole des Typs „Uzi“, eine Selbstladebüchse des Typs „Winchester“ sowie ca. 140 Wurfkörper und Signallichter gefunden. All diese Waffen, deren Munition als auch die Leuchtsignale, welcher nach dem Gesetz unter Sprengkörper gehandelt werden, wurden nicht sorgfaltsgemäß eingelagert, noch konnte eine Erlaubnis für den Besitz dieser Gegenstände nachgewiesen werden.
Der Fall wurde vor dem Landgericht Schwerin verhandelt, welches den ehemaligen Elite-Polizisten zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilte, wonach deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wurde. Gegen dieses Urteil wandte sich die Staatsanwaltschaft mit einer Revision zum 6. Strafsenat des Bundesgerichtshofes. Diese sah eine Problematik der Würdigung der Feststellungen des Landgerichts gegenüber der gefundenen Maschinenpistole sowie dem letztendlich ausgesprochenem Strafmaß, v.a. in Verbindung mit der Bewährungsaussetzung.
Die Richter am Bundesgerichtshof sahen in der Entscheidung des Landgerichts jedoch keine Beanstandung. Die – wenngleich knappen – Feststellungen des Landgerichts bezüglich der Aufbewahrung der Maschinenpistole seien schlüssig und exakt in eine Zeitachse einzubeziehen. Auch die auf Dauer bestandene Zugriffsmöglichkeit auf die Waffe seitens des Angeklagten wurde vom Gericht zielführend berücksichtigt.
Des Weiteren gehen die Richter davon aus, dass eine zur Bewährung ausgesetzte Freiheitsstrafe im vorliegenden Fall keine verharmlosende Gesamtwürdigung der Tathandlung sowie der Täterpersönlichkeit darstellt, sondern im Sinne der kriminalpolitischen Prognose bezüglich des Sozialverhaltens des Täters angemessen ist und keine wesentlichen Umstände gegen einen solchen Schuldspruch sprechen.
Letztendlich hält der Schuldspruch der rechtlichen Überprüfung stand, was dazu führt, dass die Revision der Staatsanwaltschaft abgewiesen wurde.
Bundesgerichtshof, Urteil vom 11.02.2021 – 6 StR 235/20 –
Foto: AdobeStock Nr. 254371827 (Symbolbild)
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das Landgericht Berlin hat in seinem brandaktuellen Urteil vom 02.03.2021 eine weitere Entscheidung des sogenannten „Kudamm-Raser-Falles“ erwirkt. Nach nun mehr als fünf Jahren seit dem Vorfall des tödlichen Autorennens in der Berliner Innenstadt wurde der Hauptangeklagte Marvin N. nun zu einer Haftstrafe von 13 Jahren verurteilt.
Der Vorfall ereignete sich am 01. Februar im Jahre 2016. Nach den nun weitreichenden Feststellungen der Gerichte steht fest, dass die beiden Männer, die in dem PS-Kräftemessen verwickelt waren, mit bis zu 170 Kilometern pro Stunde über den Kurfürstendamm durch die Berliner City-West gerast sind. Der bereits rechtskräftig verurteilte Herausforderer rammte schließlich den Jeep eines unbeteiligten Verkehrsteilnehmers, welcher rechtmäßig bei grüner Ampel in die Kreuzung eingefahren ist. Durch die Kollision ist das Fahrzeug des Rentners ca. 70 Meter weit durch die Luft geschleudert worden. Der Fahrzeugführer verstarb noch am Unfallort. Die beiden Raser seien anschließend vom Unfallort geflüchtet.
Der Fall beschäftigt die Justiz nun bereits seit Jahren. In erster Instanz sprach das Landgericht Berlin im Februar 2017 erstmals die Höchststrafe für eine solche Raser-Konstellation aus: Verurteilung wegen Mordes – Lebenslange Freiheitsstrafe.
Gegen dieses Urteil wurde Rechtsmittel eingelegt. Die Revision wurde vor dem Bundesgerichtshof verhandelt, welcher das Urteil des Landgerichts vollständig aufhob und an dieses zurückverwies. Im Jahre 2019 kam eine andere Strafkammer des Landgerichts Berlin erneut zum selben Schuldspruch, begründete diesen jedoch juristisch differenziert. In der damalig zweiten Entscheidung lag das Augenmerk auf den sogenannten Mordmerkmalen, welche bei Erfüllung die Sanktion der lebenslänglichen Freiheitsstrafe des Mordes rechtfertigen. Im Urteil hieß es damals, das Opfer sei völlig arg- und wehrlos gewesen. Bei der enormen Geschwindigkeit und unüberschaubaren Situation seien die Autos zum gemeingefährlichen Mittel geworden, deshalb sei ein solches Mordmerkmal erfüllt.
Diese Argumentation bestätigte der BGH in der erneuten Revision. In der Entscheidung aus dem März 2021 geht es jedoch vorrangig um den Mittäter, welcher nicht mit dem Fahrzeug des Rentners kollidierte, aber dennoch im Sinne einer Mittäterschaft der Mord zugerechnet werden soll.
Die Richter am Landgericht Berlin betonten, dass dem mittlerweile 29 – Jährigen keine täterschaftliche Mitverantwortung für den unmittelbaren Tod des Rentners anzulasten sei, denn der Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Kreuzungsbereich geschah aus reinem Zufall. Dennoch sei die Feststellung, dass dieser kurz vor der drohenden Kollision vom Gas gegangen und anschließend wieder stark beschleunigt haben soll, ausreichend, um daraus zu interpretieren, dass dieser bewusst das Risiko eines weiteren Zusammenpralles eingegangen ist, lediglich um das Rennen an dieser entscheidenden Stelle nicht zu verlieren. Daraus zogen die Richter den Entschluss, dass der Angeklagte den Tod des Fahrzeugführers bei einer drohenden Kollision billigend in Kauf genommen habe, was die Verurteilung zu einem versuchten Mord rechtfertigt.
Dennoch wird dies wohl lediglich eine weitere Entscheidung in dem spannenden Justizfall des Berliner Raser-Falles darstellen, denn der Verteidiger des Verurteilten habe bereits eine Revision zum Bundesgerichtshof angekündigt. Nun bleibt abzuwarten, wie die Richter in Karlsruhe entscheiden.
Landgericht Berlin, Urt. v. 02.03.2021, Az. 529 Ks 6/20
Foto: AdobeStock Nr. 180562724
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das Oberlandesgericht Zweibrücken hat im Herbst 2020 eine weitere Konkretisierung des § 315 c StGB unternehmen müssen. Es war fraglich, ob das ungewollte Einlegen des Rückwärtsganges und das darauffolgende versehentliche Rückwärtsfahren mit dem PKW ausreicht, um den Tatbestand des § 315 c Abs. 1 Nr. 2 f) StGB zu erfüllen. Die Richter der Revisionsinstanz sehen in dieser Tathandlung keine Erfüllung des erforderlichen Tatbestandes und verwiesen das Verfahren zurück an das erstinstanzlich zuständige Amtsgericht.
Der Entscheidung lag folgender Sachverhalt zugrunde:
Der Angeklagte befand sich auf einer weitreichenden Landstraße und wurde auf der rechten Seite von einem Motorradfahrer überholt. Da der Beschuldigte kurz davor war, mit seinem PKW abzubiegen, kam es fast zur Kollision der beiden. Aufgrund des Schockmoments entschied sich der Zeuge E mit seinem Motorrad am rechten Fahrbahnrand zu halten. Aus Verärgerung über die waghalsige Aktion des Motorradfahrers hielt der Angeklagte mit seinem Fahrzeug hinter dem Motorradfahrer an. Dabei blockierte er beide Fahrspuren, so dass ein LKW sowie ein weiterer PKW ihre Fahrzeuge komplett zum Stillstand bringen mussten. Als der Angeklagte den Motorradfahrer zur Rede stellen wollte, schaltete dieser das Automatikgetriebe seines Fahrzeuges nicht auf den Parkvorgang einleitenden Gang „P“, sondern legte ausversehen den Rückwärtsgang ein und stieg zugleich aus dem Fahrzeug aus. Als dieser bemerkte, dass sein Auto mit offener Fahrertür nach hinten rollte, sprang er wieder in seinen PKW, riss das Lenkrad herum, konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass dieses mit dem stehenden Fahrzeug hinter diesem kollidierte. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2700 €.
Das Amtsgericht sah in diesen Feststellungen eine Nötigung nach § 240 StGB sowie eine fahrlässige Straßenverkehrsgefährdung nach § 315 c Abs. 1 Nr. 2 f), Abs. 3 StGB. Zudem hat es dem Angeklagten die Fahrerlaubnis entzogen und eine Sperrfrist von acht Monaten bis zur möglichen Wiedererteilung verhängt.
Gegen dieses amtsgerichtliche Urteil wandte sich der Angeklagte mit einer Sprungrevision zum Oberlandesgericht Zweibrücken, welches das Urteil des Amtsgerichts aus den folgenden Gründen aufhob:
Nach § 315 c Abs. 1 Nr. 2 f) StGB macht sich derjenige strafbar, der grob verkehrswidrig und rücksichtslos auf Autobahnen oder Kraftstraßen wendet, rückwärts oder entgegen der Fahrtrichtung fährt oder dies versucht. Das Tatbestandsmerkmal des Rückwärtsfahrens beinhaltet – ebenso wie dasjenige des „Führens“ i.S.d. Abs. 1 Nr. 1 – ein subjektives bzw. „finales“ Element. Wer ohne seinen Willen ein Fahrzeug rückwärts in Bewegung setzt, fährt bzw. führt dieses nicht. Es reicht danach für die Erfüllung des objektiven Tatbestandes nicht aus, wenn der Täter, wie es im obigen Sachverhalt der Fall war, ungewollt sein Fahrzeug in Bewegung setzt.
OLG Zweibrücken, Beschluss vom 30.10.2020 – 1 OLG 2 Ss 49/20
Foto: AdobeStock Nr. 295358582
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht

Das Amtsgericht München musste sich in einem Urteil vom Januar 2021 mit einem gemeinschaftlichen Betrug sowie mehrfacher Urkundenfälschung in fünfzehn bzw. dreizehn Fällen zweier Frauen auseinandersetzen. Diese haben es sich im Jahre 2019 zum Hobby gemacht, Übernachtungen und Bewirtungen in Hotels und Pensionen zu erschleichen, indem Sie diese im Nachhinein ohne Bezahlung heimlich verließen. Der Tatrichter verurteilte die Hauptangeklagte zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten. Die Mittäterin kam mit einer Bewährungsstrafe davon.
Dem Fall liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
Die beiden Angeklagten haben sich im März sowie im Oktober 2019 auf einer Backpacking-Tour durch Bayern befunden. Als ihnen das Geld für Übernachtungen sowie die notwendige Verpflegung ausgingen, begannen Sie, unter wechselnden Personalien unter anderem von Freundinnen und Bekannten unterschiedlichste Ferienwohnungen, Gasthöfe, Hotels und Pensionen zu beziehen und im Nachhinein heimlich ohne Bezahlung zu verlassen.
Die Kosten dieser Herbergen beliefen sich dabei zwischen 146 – 315 Euro pro Nacht. Dieser gemeinschaftlich begangene Betrug konnte den beiden Frauen im Alter von 63 und 60 Jahren fünfzehnmal nachgewiesen werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 8.937 Euro. Sie gaben an, die Route zwischen den einzelnen Stationen, im Frühjahr Germering und Feldafing, im Herbst Hausham, Kreuth, Gmund am Tegernsee, Krün, Steingaden, Bad Bayersoien, Oberau, Garmisch-Partenkirchen, Kochel, Bad Tölz, Bad Heilbrunn, Dietramszell und Schongau, mit ihrem Hund jeweils zu Fuß bewältigt zu haben.
Die Hauptangeklagte 63 – Jährige, welche bereits vielfach vorbestraft und insgesamt über zehn Jahre im Gefängnis verbracht hat, räumte die Taten in einem vollumfänglichen Geständnis ein. Sie gibt in ihrer Einlassung an, dass die beiden Damen zu ihren Taten getrieben wurden, da Sie sich mit ihrem Budget für die Reise völlig verschätzt hatten, jedoch aufgrund des Schamgefühls keinen Kontakt zu ihren Angehörigen aufnehmen wollten.
Die Tatrichterin hat das vollumfängliche Geständnis als erheblich strafmildernd gewertet. Dabei seien laut ihrer Aussage auch die Besonderheiten der Situation zu werten. Nach ihrer Ansicht wurde den dreizehn Zeugen, welche in der Hauptverhandlung zur Beweisaufnahme verhört werden sollten, in Zeiten der Corona-Pandemie und des Lockdowns eine zusätzliche Anreise sowie eine Aussage vor Gericht erspart geblieben. Dies spreche für das Moralgefühl der Angeklagten. Des Weiteren sei zu betonen, dass sich die beiden Damen bereits seit 8,5 Monaten seit ihrer Ergreifung im Januar 2020 in Untersuchungshaft befanden, da eine zunehmende Flucht – sowie Verdunkelungsgefahr anzunehmen war. Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in der Haft war diese für die Beiden als besonders empfindlich einzustufen und demnach auch zu gewichten.
Dennoch sprechen gegen die Täterinnen eine äußerst dreiste Vorgehensweise, welche eine Verunglimpfung ihrer Freunde und Bekannten in Kauf nahmen, um ihre Taten zu realisieren. Bei ihren Zechprellereien wurden durchgehend Mittel – sowie Hochklassehotel gewählt, so dass ein gewisser Standard zu erkennen war. Dort wurden zudem immer auch Getränke und Speisen verzehrt, welche stets auf die Zimmerrechnung gebucht wurden.
Aufgrund der kriminellen Vorgeschichte der 63 – Jährigen Hauptangeklagten sah die Richterin keine andere Möglichkeit, als eine Vollzugsstrafe von drei Jahren und sieben Monaten auszusprechen. Bei der 60 – jährigen Mittäterin, welche in ihrer Vergangenheit lediglich geringfügig vorbestraft ist, wurde die verhängte Freiheitsstrafe von einem Jahr und vier Monaten zur Bewährung ausgesetzt. Dies argumentierte die vorsitzende Richterin mit dem bereits in der U-Haft aufgetretenen erstmaligem und langem Haftdruck, welcher einen tiefgründigen Präventionsgedanken der Mitangeklagten erweckt haben soll.
Amtsgericht München, Urteil vom 28.01.2021 – 812 Ls 251 Js 191258/20 –
Foto: AdobeStock Nr. 249175685
Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass es einer genauen Prüfung des Einzelfalls bedarf, um herauszufinden, ob sich Ihr eigener Sachverhalt genau mit dem oben geschilderten Anwendungsfall deckt. Für diesbezügliche Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.
Zudem übernimmt in der Regel eine Rechtsschutzversicherung alle Anwaltskosten und auch die Verfahrenskosten eines Rechtsstreits. Wir informieren Sie auf jeden Fall gerne im Voraus zu allen anfallenden Kosten.
Sven Skana
Fachanwalt für Verkehrsrecht
Anwalt für Strafrecht